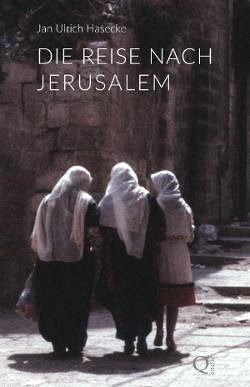In jener Nacht im März 1942, als unsere Mutter mich wach rüttelt, fliegen bereits britische Bomberverbände das Ruhrgebiet an. »Los Lore, aufstehen. Jeden Moment kann es Fliegeralarm geben. Im Radio ist bereits Feindeinflug gemeldet worden. Steh auf!« »Ach, lass mich doch schlafen. Vielleicht gibt es ja gar keinen Alarm!« Ich dreh mich wieder auf die Seite. Mama wird ärgerlich: »Los, raus aus den Federn!« Sie zieht das Oberbett weg und ich rolle mich verdrießlich im Trainingsanzug aus dem Bett. Wir ziehen seit Monaten keine Nachthemden mehr an. Meine beiden großen Brüder, die schon in die Schule gehen, hantieren in der Wohnküche. Sie ärgern mich oft und ziehen an meinen kurzen Zöpfen, nur weil ich ein Mädchen und die Kleinste bin. Der Frisör hat den Jungen die Haare zu kurz geschnitten. Ihre Ohren sind jetzt viel zu groß. Die Fenster in der Wohnung sind verdunkelt.
Mit einem Satz springe ich aus dem Bett, als die Sirenen losheulen, ohne Voralarm dieses Mal. In kurzen Abständen immer wieder auf und ab, auf und ab, auf und ab. Sie verkünden Vollalarm. Die Flak ballert ohrenbetäubend los. Die Flakstellung befindet sich ganz in unserer Nähe auf dem Feld von Bauer Vogelsang. Die langen Rohre der schweren Geschütze sind weithin sichtbar. Das laute Dröhnen der schweren Bomberverbände überfällt uns unerwartet. Uns bleibt gar keine Zeit. Wir hasten ins Treppenhaus und vergessen dabei nicht, unsere Gasmaskenkartons und die kleinen Luftschutzkoffer, die immer in der Diele bereit stehen, mitzunehmen. Ich trage den kleinsten Koffer. Die Fenster im Hausflur sind mit Decken abgedichtet. Die Glühbirnen im Flur sind schwarz angestrichen und verbreiten nur spärliches Dreiminutenlicht. Unsere Wanduhr auf der Diele schlägt elf mal. Ihr vertrauter Klang gehört in mein Leben wie Essen und Trinken. »Bomberverbände sind das. Beeilt euch!« ruft mein Bruder Karlheinz. Die übrigen Hausbewohner hetzen an uns vorbei, als sei der Teufel hinter ihnen her, um in den notdürftig hergerichteten Luftschutzkeller zu gelangen. »Rennen Sie doch die Kinder nicht um!« ruft unsere Mutter empört. Draußen ist die Hölle los. »Kommt schon! Kommt schon!«
Zitternd setzen wir uns, in der Waschküche angekommen, auf unsere Stammplätze. Ein paar Notbetten sind dort für uns Kinder neben den großen mit Löschwasser gefüllten Steinbottichen aufgestellt. Es ist kalt und feucht hier unten. Ostern steht vor der Tür. Tagsüber ist der Himmel blau. Mama hat gestern im Garten Blumen gepflanzt. Ich habe Radieschen gesät. »Lasst uns in den Kellerflur rübergehen«, meint mein Bruder Hubert. »Dort ist es sicherer.« Er hat recht. Die Flak schießt. Die Flugzeuge dröhnen. Wir haben panische Angst. Das Licht geht aus. Taschenlampen blitzen auf. Die Hausgemeinschaft, bestehend aus vier Familien, sucht den schmalen Gang zwischen den einzelnen Kellerräumen auf. Die Ehepaare sind untereinander zerstritten. Wir Kinder dürfen nicht miteinander sprechen. So nah, schrill, laut und durchdringend haben wir sie noch nie rauschen und pfeifen hören, die Bomben. Die Einschläge in unmittelbarer Nähe sind nicht auszuhalten. Der Luftdruck der niedersausenden pfeifenden Bomben bringt unsere Trommelfelle beinahe zum Bersten. Das Haus bebt und schwankt. »Ausatmen!«, befiehlt Mama. Sie befürchtet, von dem Luftdruck könnten unsere Lungen platzen. Beschützend, um die herumfliegenden Glassplitter von uns abzuhalten, breitet sie eine große Wolldecke über die Köpfe von uns drei Kindern aus Die Glühbirnen unter der Kellerdecke platzen. Die Waschküchentür fliegt auf die Notbetten, die mit Getöse zusammenkrachen. Wir Kinder japsen nach Luft, die plötzlich erfüllt ist von Mörtel und Kalkstaub. Die Menschen verharren still. Wir sitzen oder liegen auf dem kalten, bebenden Zementboden. Kellertüren werden aus den Angeln gerissen. Die Scheiben in den kleinen Kellerfenstern nach draußen zerplatzen in unzählige glitzernde Bruchstückchen. Grelle Blitze zucken herein. Es pfeift und donnert. Jeder neue Luftdruck reißt unserm Nachbarn, Herrn Malhofer, die Schirmmütze vom Kopf, die er sich immer wieder heranholt und überstülpt. Mein Bruder Karlheinz hält es nicht aus unter Decke. Sein Kopf schnellt hoch. »Bleib gebeugt!«, zischt Mama ihm zu. Das Inferno nimmt kein Ende. Wir haben kein Zeitgefühl mehr. »Ausatmen! Ausatmen!« Herrn Malhofers Griff nach der Mütze. Karlheinz’ vergebliche Versuche, unter der Decke hochzukommen. Dann betet laut weinend und schreiend Frau Grasedieck, unsere Lieblingsnachbarin: »Hilf Maria, es ist Zeit! Hilf Mutter der Barmherzigkeit!« Sie kommt nicht weit. Dieses beinahe alles übertönende, hysterische, laute Beten beruhigt keineswegs die übrigen Gemüter. Mit unnatürlich hoher Stimme gibt Mama ihr zu verstehen: »Frau Grasedieck, schreien Sie nicht so laut! Denken Sie an die Kinder!« Die Antwort, schon leiser, kaum hörbar: »Herr, Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden!« Was meint sie nur damit? Ich leiere im Stillen mein Standardgebet herunter: »Lieber Gott, beschütze uns doch bitte alle. Bitte, bitte.« Immer wieder dasselbe. Im Hausflur und auf den Steintreppen geschieht plötzlich etwas nicht Erkennbares, Unfassbares, Furchtbares. Was ist das? Unheimlich laut und schwer poltert wohl ein riesiges Etwas die Treppen herunter. Wir horchen und erstarren vor Angst. Dieses Etwas wird immer lauter, nähert sich bedrohlich. Gleich muss es im Keller angelangt sein. Ist das der Tod? Ich krümme mich noch mehr und spüre Mamas schützende Hand auf meiner Schulter. »Das ist nur der Kamin, der sich wohl gelöst hat und nun die Treppen im Haus herunterprasselt.« Wirklich? Dieses unheilvolle Etwas schafft es nicht bis zu uns heran. Das Poltern verstummt. »Der Schornstein ist wohl im Hausflur über uns liegen geblieben«, flüstert Mama heiser vor Entsetzen. Immer wieder zieht sie erneut die Decke über unsere Köpfe. »Gleich ist bestimmt alles vorbei, und wir können raus hier.« Ein neues, kurzes, nervenzersägendes Heulen, schrill und unerträglich, ein Singen, ein Aufschlag. Der Luftdruck zerreißt uns fast. Leben wir? Die Wolldecke wird unserer Mutter aus den Händen gerissen. Wir werden durch den Keller geschleudert. Kein Mensch schreit. Dann herrscht eine unheimliche Stille, bis Herr Grasedieck fragt: »Ist jemand verletzt?« »Nein,« lauten die Antworten aus verschiedenen Richtungen. »Die Bombe ist nicht auf unser Haus gefallen. Denn dann wären wir alle tot«, sagt Mama. »Die Flieger wollten sicher die Flakstellung treffen.« Wir leben in einer luftleeren Zeitlosigkeit Unser Atem stockt. Sterben wir jetzt?
Wir haben uns kaum hochgerappelt, da dringen plötzlich laute Männerstimmen von draußen vom Hof herein zu uns: »413, sofort raus. Das Haus brennt. Es kann jeden Moment einstürzen!« 413 sind wir. »Das sind die Männer vom SHD1, die immer bei Fliegeralarm unterwegs sein müssen«, weiß Mama. Feuer prasselt. Roter Schein erhellt den Keller. Der Qualm löst bei uns allen einen starken Hustenreiz aus. »Wir müssen raus, sofort!« ruft Karlheinz, mein großer Bruder. »Sofort«, wiederholt er. »Es können doch noch Bomben fallen!« gibt Frau Malhofer zu bedenken. »Sollen wir denn hier verrecken?« mischt sich mein Bruder Hubert ein. »Los, los, macht schon, voran!« Das ungeheure, beängstigende Dröhnen der Bomberverbände ist verstummt. Bemerken wir das überhaupt? Doch. Die Flak schießt nur noch aus der Ferne. »Wo ist dein rechter Schuh?« fragt mich unsere Mutter. »Weiß ich nicht, habe ihn wohl verloren. Ich finde ihn nicht.« »Raus hier! Raus hier!« Meinen Schuh vergessen wir in der entstandenen Panik. Alle schreien wild durcheinander. Aber so einfach ist das nicht mit dem Rauskommen. Die Holztreppe, die aus dem Keller nach oben führt, können wir nicht mehr benutzen. Im Haus kracht und rumort es unaufhörlich. Schwere Möbelstücke scheinen ihre lärmenden Spielchen zu treiben. Unsere Augen brennen und tränen entsetzlich. Hoffentlich stürzt das Haus nicht ein und begräbt uns. Die Männer, Herr Malhofer nun doch ohne Schirmmütze, versuchen, einen schmalen Durchgang nach draußen durch die Waschküche zum Hof freizuräumen. Jedoch ist die Waschküchentür, die ins Freie führt, herausgerissen. Das so entstandene Loch ist zugestopft mit Mauerstücken. Die zum Schutz einmal flüchtig vorgebaute Mauer, die als Splitterfang dienen sollte, ist zerstört und anstatt uns zu schützen, versperrt sie uns nun den Weg nach draußen.
Gott sei Dank, wir sind in dieser Nacht nicht allein auf dieser unserer Erde. Hilfreiche Hände räumen von außen den Schutt weg. Und bald kriechen wir hinaus in eine Welt, die nicht mehr die unsere ist. Wir robben uns hintereinander raus, schieben unsere armseligen Koffer vor uns her und stolpern in eine glutrote knisternde Nacht Die Hände der Männer bluten. Wir laufen in unseren Garten, den wir gestern noch bepflanzt haben. Die Erde ist aufgewühlt. »Hast du deinen Schuh?« fragt Mama. »Ach lass doch!« »Du kannst in Phosphor treten«, sorgt sich Hubert. Die Luft ist rauchgeschwängert. Unser Haus brennt und stürzt nach und nach in sich zusammen. »Da nutzen die kärglichen Löschversuche nichts«, meint Herr Malhofer. Wir müssen tatenlos zusehen, wie unsere Wohnung ausbrennt. Meine Lieblingspuppe, die ich sonst nie vergessen habe, ist in dieser Nacht in der Wohnung liegen geblieben. Ich weine, weil ich sie nicht beschützt habe. »Ist doch nur eine Puppe, du Heulsuse«, meint Hubert verächtlich. »Sei froh, dass wir am Leben sind.«
Der Flugzeugspuk am Himmel ist verstummt. Gebäude sacken in dieser Nacht in Bochum zusammen wie Kartenhäuser. Ein Stück Sternenteppich mit dem Mond in der Mittel hängt hinter der roten Feuersäule. Aus unseren verkrampften Gesichtszügen weicht langsam die Todesangst. Die Bomber sind ihre schwere Last los geworden und haben abgedreht. Über dem Flammenmeer fliegen sie ohne den schweren Ballast der Bomben zurück nach Hause. Unser Zuhause haben sie gnadenlos zerstört. »Das waren Engländer«, sagt Karlheinz. »Adolf Hitler hat zu denen mal gesagt: ›Wir versenken eure Insel ins Meer.‹« Prasselnd reißen die Flammen immer mehr Gebälk herunter. Feuerwehrleute und Männer vom SHD versuchen, uns aus unserem Garten zu vertreiben. Aber wohin sollen wir denn in dieser brennenden Nacht gehen? Mama will warten, bis es hell geworden ist. Traurige, dreckige, zerlumpte, heimatlose Gestalten hocken auf den paar geretteten Luftschutzkoffern und auf den übrig gebliebenen wackeligen Gartenstühlen. Weinen. Reden miteinander. Eine Flasche Bananenlikör macht die Runde. Die Flammen erhellen gespenstisch das Geschehen. Wer hat die Flasche spendiert? Ich glaube, unser Vater hatte sie im letzten Heimaturlaub mitgebracht. Gab es einmal Streit unter den Nachbarn? Wann soll das gewesen sein? Wir spenden uns gegenseitig Trost, bis der Morgen graut und das Feuer beinahe gebändigt ist. Gespenstisch ragen Ruinen in den sich aufhellenden Tag. »Es besteht weiterhin Einsturzgefahr! Bringen Sie sich endlich in Sicherheit!« Das sind gut gemeinte Ratschläge der Einsatzleute. Wir werden nie mehr unsere schöne Wohnung betreten können. Mich packt wahnsinniges Heimweh und ich weiß nicht, wonach. Unser Balkon ist herabgestürzt. Die großen Betonstücke haben sich im Hof verteilt. Unsere Trainingsanzüge hängen zerfetzt und dreckig an uns herunter. Der neue Tag schenkt uns eine runde, bleiche Sonne. Meine Brüder, die sich einfach zu einem Kontrollgang davon gestohlen haben, kommen zurück. »Die Wiesen des Bauern Vogelsang sind von riesigen Bombentrichtern aufgerissen«, sagen sie. Mama, die vor Sorge nicht aus noch ein wusste, schimpft mit ihnen. »Sei doch froh, dass die Bomben nur ins Feld gefallen sind!«, verteidigen sich die beiden Jungen.
In unser Haus sind in dieser Nacht unzählige Brandbomben eingeschlagen und explodiert und haben das Riesenfeuer entfacht. Der Dachboden war weggebrannt, als der Kamin herunterpolterte. Die schweren Bomben, die ganz in der Nähe fielen, haben das Haus durch den Luftdruck aus den Angeln gerissen. Die Viertelstunde Ewigkeit, die wir durchlebt haben, gehört in einen für uns Menschen nicht nachvollziehbaren Zeitbegriff.
Mein Bruder Hubert hält mir plötzlich meinen rechten Schuh unter die Nase. Wo hat er den nur gefunden? Er verrät es nicht. Ich ziehe den Schuh an. Mama kann wieder lächeln. »Hoffentlich sind keine Blindgänger gefallen, die irgendwann einmal explodieren, wenn kein Mensch daran denkt«, sagt Karlheinz. Und Hubert trällert: »Lore, Lore, Lore, schön sind die Mädchen von 17/18 Jahr’n.« Ein Lied, das die Soldaten singen. Mamas Haarknoten hat sich gelöst. Sie hat wohl sämtliche Haarnadeln verloren. Ihr schwarzes Haar fällt lang über ihre Schultern. Sie flicht es zu einen Zopf. Ich habe zwei rote kurze Zöpfe, die auch neu geflochten werden. Plötzlich bemerken wir, dass wir mit dem Ehepaar Grasedieck die Letzten sind, die noch hier herumlungern. Wir haben gar nicht registriert, dass die anderen Nachbarn von irgendwelchen Bekannten oder Verwandten abgeholt worden oder einfach gegangen sind. Mama und Frau Grasedieck reden miteinander. Wir mögen Frau Grasedieck sehr gerne. »Was soll nur aus uns werden? Das darf so nicht weitergehen! Dieser schreckliche Krieg!« sind Bruchstücke, die bis zu mir dringen. Ich suche nach den gekennzeichneten Beeten, auf die ich gestern Radieschen gesät habe. Da ist aber nichts mehr zu entdecken. Mich erleichtert unbeschreiblich, dass der Gaskessel in unserer Nähe nicht getroffen worden ist. Und wieder einmal heulen die Sirenen. Dieses Mal dreimal kurz hintereinander. Das bedeutet »nur« Voralarm. Mama zeigt sich nicht beeindruckt. Das Ballern der Flakgeschütze dringt aus weiter Entfernung zu uns. Nach kurzer Zeit verkündet ein lang gezogener Sirenenton Entwarnung. »Das waren nur die feindlichen Aufklärer«, sagt Mama. »Da passiert nichts.«
Wir verabschieden uns endlich von Grasediecks, und wollen uns, da es inzwischen hell genug geworden ist, zu unseren Großeltern nach Essen durchkämpfen, wenn überhaupt Züge fahren nach dieser Nacht. Die beiden wollen uns bis zur Straße begleiten. Sie warten auf ihre erwachsene Tochter Erna, die sie wohl abholen wird. »Auf Wiedersehen.« »Auf Wiedersehen.« Mama laufen die Tränen über das Gesicht und hinterlassen helle Spuren. Meine Brüder sind putzmunter und haben schon als Andenken eine große Tüte voller Bombensplitter gesammelt.
Frau Grasedieck gerät plötzlich außer sich. Sie hat zwischen den Trümmern ein Kästchen entdeckt, das wohl ihr gehört. Sie stürzt wie besessen vorwärts und stört sich nicht an den Rufen ihres Mannes. Sie stolpert in ihren Pumps und den zerrissenen Seidenstrümpfen vorwärts, kniet nieder in Schutt und Asche und reißt das Kästchen an sich. In diesem Augenblick neigt sich der in gerissenen Stahlseilen herunterhängende Balkon der Parterrewohnung zur Seite, und mit lautem Krachen begraben die schweren Betonplatten Frau Grasedieck unter sich. Aus welchen Kehlen stammen die markerschütternden gellenden Schreie? Das darf nicht sein! Wir haben doch alle überlebt! Ich höre nicht auf zu schreien. Menschen von der Straße eilen herbei. Karlheinz hält Mama zurück, die nach vorne laufen will. »Mama, siehst du nicht, Frau Grasedieck ist tot!« Eine Hand ragt aus einer kleinen Spalte zwischen den Betonmauern hervor. Erna, die erwachsene Tochter, fängt Herrn Grasedieck auf, der zusammenbricht. Gott sei Dank ist sie wenigstens da! Laut schluchzend hält sie ihren Vater in den Armen. Männer versuchen, die schwere Betonplatte anzuheben, was ihnen jedoch nicht gelingt. Die Luft riecht nach Schwefel.
Wir können uns nicht beruhigen. »Lieber Gott, warum hast du das zugelassen?« frage ich.
Ein Rotkreuz-Helfer fährt unsere Mutter wütend an: »Verschwinden Sie endlich mit Ihren Kindern! Sehen Sie nicht, wie Ihr kleines Mädchen aussieht! Das Grundstück ist ab sofort gesperrt. Es besteht immer noch Einsturzgefahr. In der Sammelstelle vom Roten Kreuz wird man Ihnen eine vorläufige Unterkunft zuweisen, und Sie und Ihre Kinder bekommen heißen Tee und was zu essen. Helfen kann hier niemand mehr.«
Und wir gehen. Nein, wir gehen nicht! Wir schleichen uns mit hängenden Köpfen vom Ort des furchtbaren Geschehens davon. Herrn Grasedieck bekommen wir nicht mehr zu Gesicht. Die Koffer schleifen wir hinter uns her. Was murmelt unsere Mutter da: »Herr Dein Wille ist geschehen hier auf Erden.« Wie meint sie das nur?
Wir begeben uns nicht in die Sammelstelle vom Roten Kreuz. Wir quälen uns durch die von qualmenden Ruinen und entwurzelten Bäumen eingesäumten Straßen. Zerstörte Straßenbahnen liegen umgekippt auf den Schienen der Hattinger Straße.. Elektrische Hochleitungsdrähte hängen herunter. Nichts kann uns aufhalten. Menschen begegnen uns. Sie bergen, graben und weinen. Wir erreichen irgendwann an diesem Tag, der immer wieder von kurzen Fliegeralarmen unterbrochen wird, Bochums Hauptbahnhof, der in dieser Nacht nicht zerstört worden ist. Wir glauben fest daran, dass uns nicht ein zweites Mal so was Schreckliches wie in der vergangenen Nacht und heute morgen widerfahren wird. Und irgendwann steigen wir todmüde und abgekämpft in einen Zug, der Richtung Essen fährt
Es war kein Großangriff. Es sollte alles noch viel schlimmer kommen.
-
Sicherheitshilfsdienst ↩︎