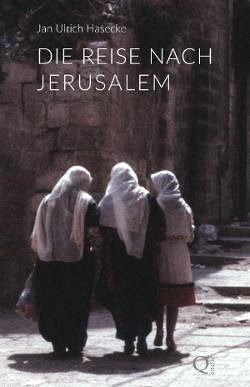Leseprobe
Aus dem Roman
Warum? Der lange Abschied
ISBN: 3-8311-2089-7
Es war im Frühling 1944, ich war gerade sechzehn Jahre alt geworden. Die Zeiten wurden immer gefährlicher und erbarmungsloser. Wieder war ich auf mich allein gestellt, wieder war ich auf der Flucht. Ich stand verzweifelt im Bahnhof von Wilhelmshaven und fürchtete mich vor jedem, der mich ansah oder sich nur länger in meiner Nähe aufhielt.
Die Züge fuhren sehr unregelmäßig. Ich hatte mir eine Fahrkarte nach Köln gekauft und musste warten.
Im Bahnhof patrouillierte die Militärpolizei, die gefürchteten “Kettenhunde”. Ich schwitzte vor Angst, meine Hände waren feucht und ich musste mich sehr beherrschen, nicht in Panik zu geraten.
Endlich kam der Zug. Als Gepäck hatte ich nur eine kleine Tasche, mehr besaß ich nicht. Ich stieg ein und fühlte mich etwas sicherer. Die “Kettenhunde” standen draußen vor der Tür auf dem Bahnsteig, langsam beruhigte ich mich. Als der Zug sich endlich in Bewegung setzte und den Bahnhof hinter sich ließ, atmete ich befreit auf.
Das Abteil, in dem ich einen Sitzplatz gefunden hatte, war voll besetzt, das Gepäcknetz voller Koffer. Wir waren schon eine Weile gefahren, als es plötzlich hieß: “Ausweiskontrolle!” Ich war wie gelähmt und hatte das Gefühl, nicht mehr atmen zu können. Das konnte für mich das Ende bedeuten. Mit meiner ganzen Energie verdrängte ich diesen Gedanken. Entweder aufgeben oder alles riskieren. Ich entschied mich für das Risiko.
Jeder hatte seinen Ausweis in der Hand und wartete auf die Kontrolle. Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen. Wegen der nächtlichen Fliegerangriffe war das nicht ungewöhnlich, man nutzte jede Gelegenheit, sich auszuruhen oder zu schlafen. Ich hoffte auf das Desinteresse oder die Anständigkeit meiner Mitreisenden. Dann erreichte der “Kettenhund” unser Abteil, stieß mich an und meinte: »Deinen Ausweis bitte!« Ich tat etwas verschlafen, griff aber nach meiner Tasche und suchte aufgeregt nach meinem Ausweis. Dann schaute ich den “Kettenhund” ängstlich an und sagte: »Er ist wahrscheinlich da oben in meinem Koffer.« Dabei zeigte ich auf den größten, ganz unten liegenden Koffer. Würde er verlangen, den Koffer herunter zu holen und zu öffnen? Würde sich der Eigentümer des Koffers melden? Niemand sagte mehr etwas, es war sehr still im Abteil, die Atmosphäre gespannt. Mein Herz schlug laut, meine Hände zitterten und wurden feucht. Ich schob sie unter meine Tasche und bemühte mich, möglichst ruhig zu erscheinen. Der “Kettenhund” bemerkte meine Aufregung, legte sie aber zu meinen Gunsten aus. Er nahm an, ich sei beunruhigt, weil ich meinen Ausweis nicht fand oder nicht dabei hatte. Nach endlosen Sekunden, ich wollte schon aufgeben, sagte er mit warnender Stimme und erhobenem Zeigefinger : »Wir wollen es durchgehen lassen, aber nicht noch einmal.« Ich bedankte mich höflich, und er verließ das Abteil.
Ich atmete auf und bemühte mich, nicht zu zittern, weinen konnte ich schon lange nicht mehr. Zum Glück gab es bis Köln keine weiteren Ausweiskontrollen mehr.
Nach kurzer Zeit war im Abteil alles wieder so, als wäre nichts geschehen, obwohl alle Mitreisenden gemerkt haben müssen, dass mit mir etwas nicht stimmte. Keiner stellte unangenehme Fragen, niemand sagte mehr ein Wort über das Vorgefallene. Wir bildeten eine stille Gemeinschaft. Alle hatten geschwiegen und schwiegen auch weiterhin. Man las weiter die Zeitung, wechselte ein paar belanglose Worte oder schaute interessiert aus dem Fenster.
Einer von ihnen, der Eigentümer des großen Koffers, hatte mir sehr geholfen und mich nicht verraten. Ich wusste nicht, wer es war und konnte mich deshalb auch nicht bei ihm bedanken. Wahrscheinlich hatte er mir durch sein Schweigen das Leben gerettet. Ich war immer noch sehr aufgeregt und versuchte, mich unbedingt zu beruhigen.
Später sah ich, wie eine etwa vierzigjährige Frau “meinen” großen Koffer aus dem Gepäcknetz nahm und ausstieg. Sie hat das Abteil verlassen, ohne mich anzusehen. Wahrscheinlich war das die einzig richtige Entscheidung.
Ich musste an den Mann in der Straßenbahn denken, der meinem Vater den Zehnmarkschein in die Manteltasche gesteckt hatte. Es gab noch viele unbekannte und ungenannte stille Helden und Helfer, das sollte nie vergessen werden.
Im dritten Schuljahr bekam ich einen Lehrer, der mich schmerzlich spüren ließ, dass er mich nicht mochte. Er war Mitglied der NSDAP und trug, für jeden gut sichtbar, sein goldenes Parteiabzeichen auf dem Revers seines Anzuges. Dieses Abzeichen verunsicherte mich, flößte mir großen Respekt, sogar Angst ein. Inzwischen wusste ich, dass gegenüber Menschen mit diesem Abzeichen für mich höchste Vorsicht geboten war.
Für die geringste Kleinigkeit bestrafte der Lehrer mich sehr hart, viel härter als alle anderen Kinder. Er war auch unser Turnlehrer, und es war seine Art, immer ein Riedstöckchen in der Hand zu halten. Meistens schlug er damit so fest auf Hefte oder Schulbücher, dass es laut knallte. Die Jungen bekamen mit dem Stock auch öfter eins auf den Hosenboden. Vorsorglich hatten sie meistens ein dünnes Heft in der Hose, damit die Wirkung der Schläge gemildert wurde.
Auch in der Turnhalle hatte er sein Stöckchen immer dabei. Als Linkshänderin hatte ich große Probleme, wenn es hieß: »Rechts herum, links herum!« Ich war schon vor Beginn der Turnstunde sehr aufgeregt und drehte mich oft in die falsche Richtung, meistens aus purer Angst. Bei jedem Fehler schlug der Lehrer mich heftig mit dem Stock auf den Rücken. Durch das dünne Turnhemdchen taten die Schläge doppelt weh.
Als ich mich abends auszog und mein Nachthemd anziehen wollte, sahen meine Eltern die blutunterlaufenen und angeschwollenen Striemen. Nie habe ich meinen Vater so wütend gesehen. Für ihn war es vermutlich unerträglich, dass er mir nicht helfen konnte. Ein Gespräch zwischen ihm und dem Lehrer hätte sicherlich zu einem Eklat geführt. Meine Mutter hat nach einer Rücksprache in der Schule auch nichts erreicht. Ich nehme an, auch sie wurde abgewiesen und beleidigt.
Wegen des infamen Verhaltens dieses Lehrers sahen mich bald einige meiner Mitschüler als “Freiwild” an. Auf dem Schulhof lachten sie mich aus und sangen dabei:
»Krumme Juden ziehn dahin, daher,
sie ziehn durchs Rote Meer,
die Wellen schlagen zu.
Die Welt hat Ruh.«
Oft bezog ich in der Pause heftige Prügel. Einzelne Mitschülerinnen versuchten mich zu beschützen, wurden dann aber selbst auch angegriffen und als “Judenfreunde” beschimpft. Als wir einmal nach der Pause zurück in die Klasse kamen, empfing mich besagter Lehrer mit den Worten: »Wie siehst du denn wieder aus?« Ich war ziemlich verschmutzt, und meine Nase blutete. Als ich ängstlich zu erklären versuchte, dass ich hingefallen sei, rief ein Junge: »Das ist nicht wahr, Herr Lehrer, die lügt, wir haben sie verhauen.« Die herzlose Reaktion des Lehrers war für mich sehr schmerzlich. Er sah mich an und sagte: »Das ist nicht schlimm, dein Vater ist ja nur ein Jude.« Seine Worte trafen mich hart und verletzten mich tief. Ich war nur noch ein kleines, verschüchtertes Mädchen, dass am liebsten sehr weit weggelaufen wäre. Der Lehrer lachte nach seiner für mich so erschreckenden Bemerkung, und einige meiner Mitschüler fühlten sich verpflichtet mitzulachen. Verständnisvoll zeigten sich mir gegenüber in der Schule die ärmeren Kinder, sie hatten viel Mitgefühl. Die Bessergestellten verhielten sich abwartend, andere aggressiv.
Ich musste mich jeden Morgen überwinden in die Schule zu gehen und habe oftmals auf dem Weg dorthin geweint. Nach wie vor war ich eine gute Schülerin, hatte aber Hemmungen, mich auf Fragen des Lehrers zu melden und die richtige Antwort zu geben. Oft hat man mich deshalb in der Pause verhauen, oder der Lehrer sagte, meine richtige Antwort sei falsch.
Wie bin ich mit diesen Aggressionen umgegangen? Wie stark war ich belastet? Wie waren meine Gefühle? War ich wütend, erregt, hatte ich Angst oder verspürte ich sogar Hass? Wie stark hat diese Situation meine Lebenseinstellung geprägt?
Mit absoluter Sicherheit kann ich sagen, dass ich niemals Hass empfunden habe. Das Gefühl des Hasses kenne ich nicht, und der Wunsch nach Rache ist mir bis heute fremd. Ich war damals vollkommen verunsichert und lebte immer in der Angst, etwas falsch zu machen.
Das Ereignis in der Schule mit diesem Lehrer war das erste Mal, dass ich mit einer solchen Brutalität und Bösartigkeit konfrontiert wurde. Natürlich hatte ich schon viel von der allgemeinen Abneigung und auch von dem Hass gegen die Juden gehört, brachte aber damit nie meinen Vater oder mich in Verbindung. Vielleicht hätte ich die damalige Situation besser verstehen können, wenn meine Eltern mit mir und meinem Bruder gemeinsam unsere Lage besprochen hätten. Da meine Eltern aber nicht miteinander redeten, wollte ich durch meine Fragen die bei uns herrschende Stille nicht stören. Deshalb sprach ich zu Hause nicht mehr über meine negativen Erlebnisse in der Schule. Ich wollte meine Eltern nicht unnötig ängstigen und ging davon aus, dass sie mir doch nicht helfen konnten.
Es fiel mir schwer und kostete mich unheimlich viel Kraft, meine jüdische Abstammung nicht als eine schlimme Krankheit zu empfinden, aber ich habe sehr darunter gelitten. Das WARUM bereitete mir große Schwierigkeiten, es war mir unverständlich, warum wir als Abschaum und Ungeziefer abgelehnt wurden. Die Liebe zu meinem Vater und mein unbeugsamer Stolz ließen mich nicht krank, aber noch empfindsamer, zurückhaltender und vorsichtiger werden. Nur wer Ähnliches erlebt hat, kann nachfühlen und ermessen, wie schmerzlich es für ein Kind ist, lieblos behandelt zu werden. Die Lieblosigkeit vieler Menschen aus meinem näheren Umfeld konnte ich mir lange Zeit nicht erklären. Ich bemühte mich immer höflich und nett zu sein, stieß aber häufig auf Ablehnung. So versuchte ich auch die ständigen Aggressionen gegen die Juden und insbesondere gegen meinen Vater, meinen Bruder und mich zu begreifen. Es gelang mir nur sehr schwer, einen nachvollziehbaren Grund dafür zu finden. Später wusste ich dann, dass nicht mein Vater oder ich die Ursache für dieses Verhalten waren, sondern die immer aggressiver werdende antijüdische Entwicklung und die Zielsetzung des immer stärker und mächtiger werdenden Nationalsozialismus.
Köln war zu jener Zeit eine sehr katholische Stadt und auch meine Gedanken bewegten sich überwiegend auf religiöser Basis. Die “bösen” Juden hatten Jesus ans Kreuz geschlagen, der Hass konnte also nur aus dieser Richtung kommen, das waren meine abwegigen Überlegungen. Aber warum verhöhnten und bestraften sie auch mich? Ich war doch katholisch und gehörte ihrem Glauben an. Ich war verzweifelt und fand für dieses Problem keine Lösung. Für meinen “ungläubigen” Vater betete ich und hoffte, ihn so vor der “ewigen Verdammnis” zu retten.
Es war grausam, ein Kind wie mich zu lehren, dass jeder, der nicht dem katholischen Glauben angehöre, in die Hölle komme und dass “die bösen Juden Jesus, Gottes Sohn, ans Kreuz genagelt hätten”. Ich fühlte mich in einer ausweglosen Situation.
Bis ich begriff, dass die Verfolgung und Vernichtung der “jüdischen Rasse” nur wenig mit der Religion zu tun hatte, lebte ich in einem großen Zwiespalt. Der “arischen Rasse” gehörte die Zukunft. Mein Vater gehörte der “jüdischen Rasse” an, somit hatte auch ich keine Zukunft zu erwarten. Das erkannte ich, als ich etwa zwölf Jahre alt war.