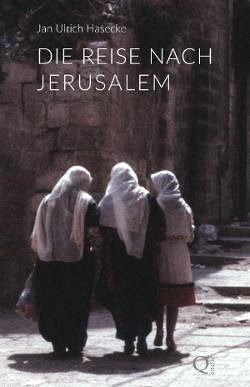Fortsetzung von »Pusteblumen im Winter«
Sonderzug ins Land des Lächelns
Wieder einmal stehen wir in trostloser Dunkelheit und klammer eisiger Kälte mit unseren Gepäckballen und Koffern auf einer fremden Straße in einer Stadt, von der wir nur den Namen kennen: Neuwied. Wir strecken unsere steif gewordenen Glieder nach dieser nervtötenden nächtlichen Busfahrt. Neuwied. Wir sind sozusagen rausgeschmissen worden. Alle sind ausgestiegen, auch die Männer in Zivil. Die werden schon wissen, wie es für sie weitergeht. Kein auf Wiedersehen oder gar gute Wünsche für unsere Odyssee. Die verschwinden sang- und klanglos aus unserem Leben.
»Verdammte Kälte« bollert Frau Hentz los. Das alte Lied:
»Mam, isch sin bang!«
»Wir wollen auch nach Bayern,« erfahren wir zum soundsovielten Male von der anderen Familie.
»Mein Gott, ich glaube, ich habe keine Ohren mehr,« sagt Hubert, »ich wunder’ mich, dass wir nicht im Rhein gelandet sind. Es ist ein wahres Wunder.«
»Rolle, rolle,« macht Brigitte. Sie streckt sich behaglich in ihrem engen Kinderwagen.
»Jetzt ston wir hee,« brummelt Frau Hentz, »mein Jott noch, wär isch doch zu Hus jeblewwe!« Das schwarzhaarige Mädchen macht sich wieder an Hans heran. Der Mond scheint, auch die Sterne leuchten, die Front wetterleuchtet. Die Straße ist unheimlich menschenleer.
»Wir suchen jetzt erst mal die nächste Rotekreuzstelle,« bringt Mama mühsam hervor. Unser Grüppchen setzt sich in Bewegung mit Sack und Pack. Wie lange dauert es, bis wir endlich Unterschlupf finden? Ich weiß es nicht. Irgendwann strecken wir in fremden, harten Betten unsere müden Glieder aus und schlafen einen tiefen Schlaf, der uns mit wilden Träumen quält. Der schönste Wachtraum erfüllt sich nicht: Frieden !
Angst? Wir erheben uns am späten Vormittag des nächsten Tages von unseren harten Lagern und hetzen vom Heulen der Sirenen gejagt in den nächstbesten Luftschutzkeller, der uns heile wieder herauslässt. Wir haben uns erkundigt. Nachmittags soll ein Zug nach Frankfurt fahren. Den wollen wir unbedingt mitkriegen. Auf dem Weg vom Luftschutzkeller zurück zur Rotekreuzstelle gibt es eine Überraschung. Irgendwo in einer Ecke dieser Rotekreuzunterkunft hat Hans eine Riesenkiste mit ungestempelten Urlauberlebensmittelmarken entdeckt. Wie haben sich die so genannten hilfreichen Geister die wohl unter den Nagel gerissen? Ist auch egal. Hans hat sich getraut und einfach eine Handvoll Urlaubermarken herausgenommen. Und erst einmal die andere Familie. Die Frau hat eine große Einkaufstasche pickepacke vollgestopft. Es tut mir heute noch in der Seele weh, dass wir zu bange waren, uns üppig zu bedienen. Auf jeden Fall hat die andere Familie ausgesorgt für den Rest des Krieges, mag er noch so lange dauern! Lebensmittelmarken sind wertvoller als Geld. Ist das Diebstahl? Ich weiß es nicht.
Wir gehen an menschenleeren hohen Mietshäusern, an ausgebrannten Fensterhöhlen und Bombenkratern vorbei um die nächste Ecke, dann auf die andere Straßenseite in unser Quartier zurück. Hans und Hubert suchen ein Lebensmittelgeschäft, um einzukaufen - Brot, Butter und Wurst - lecker! Die Frau mit den beiden Mädchen schließt sich ihnen an. Eine Rotekreuzschwester verteilt Essensgutscheine. Pro Kopf ein Mittagessen. Die Gutscheine sollen wir in einer Wirtschaft einlösen, d.h. wir müssen unser Essen dort abholen. Die Jungen kommen mit gefüllten Einkaufstaschen zurück. Ha, und wir essen erst einmal an einem kahlen Holztisch leckere Butterbrote. Ein Kanonenofen bollert in einer Ecke des karg ausgestatteten Raumes und strahlt Wärme aus. Das Leben ist schön. Das Baby trinkt sein Fläschchen - mit richtigem Zucker gesüßt - lecker! Eine Weile später machen die Jungen und ich uns auf den Weg, um die Essensgutscheine einzulösen. Es dauert, bis wir das in Frage kommende Lokal finden. Die Kneipe vorne ist leer. Wir gehen in den sich anschließenden großen Saal, war wohl mal ein Tanzsaal. Das Essen ist noch nicht fertig. Wir sollen warten. Es soll Möhreneintopf geben. Frauen in brauner Uniform säubern große gelbe Möhren und schälen Kartoffeln.
»Seid ihr beim Volkssturm?« werden die Jungen gefragt.
»Nein, wir sind auf der Durchreise.«
»So eine schlichte Frisur geziemt sich für ein deutsches Mädchen.« Damit bin ich gemeint. Ich ärgere mich und lächle hilflos. Ich mag Locken und möchte so gerne wieder welche haben! Es dauert eine Ewigkeit, bis die Kartoffeln und Möhren in zwei Riesenkochtöpfe, die je die Größe eines Riesenwaschkessels haben, verteilt werden. Ich mag keine gelben Möhren. Außerdem sind sie nicht sauber geschrubbt worden. Und wieder dauerts und dauerts, bis alles zum Kochen gebracht ist. Mama und Frau Hentz warten sicher längst auf uns. Wir beobachten, dass ein einziges halbes Pfund Margarine in beide Töpfe verteilt wird. Es brodelt in den Bottichen. Uns ist der Appetit vergangen.
»Für wen kochen die denn so viel?« fragen wir. Außer uns und den Frauen in den braunen Uniformkleidern befindet sich hier kein Mensch.
»Das Essen wird nachher abgeholt. Es ist schon ein Entgegenkommen, dass wir euch davon abgeben wollen.«
»Danke, wir mögen nichts mehr,« sagen Hubert und Hans wie aus einem Mund.
»Komm Annemie, lass die ihren Fraß alleine essen.« Ich laufe rot an und hechte hinter den beiden her.
»Ihr werdets noch bereuen und froh sein, wenn ihr so was Gutes zu essen bekommt!« Eine keifende Frauenstimme ist das!
»Pfff!« Alle Verachtung dieser Welt liegt hierin. Wir klinken die brüchige Wirtshaustür hinter uns zu und verschwinden.
»Brr, so ein Fraß!« schütteln wir uns.
»Es waren Steckrüben,« sagt Hubert, »wahrscheinlich für russische Fremdarbeiter bestimmt.«
»Ob die immer so ein schlechtes Essen bekommen?« frage ich.
Mama und Frau Hentz sind enttäuscht, dass wir nichts Warmes zu essen mitbringen.
»Hättet wenigstens an das Kind denken können! Das Kind isst gerne Möhren!« Haben wir aber nun mal nicht! Wir brühen Kaffeeersatz auf, essen wieder Brot mit Butter und werden satt. Endlich fällt uns auf, dass die Mutter mit ihren beiden Töchtern sich nicht mehr bei uns hat sehen lassen, seitdem sie einkaufen wollten.
»Wo sind die denn?«
»Vielleicht sind sie schon zum Bahnhof gegangen.« Wir ruhen uns noch ein wenig aus und verabschieden uns von der freundlichen Rotekreuzschwester, die unserer Mutter noch eine Dose Milch für das Baby mit auf den Weg gibt. Sie erklärt uns den Weg zum Bahnhof. Unsere Lebensgeister haben sich wieder gemeldet. Es wird alles gut, meinen sie. Hoffentlich haben sie recht. Leben - am Leben bleiben - nur das ist wichtig. Wir mühen uns mit unserem lästigen Gepäck durch die fremden Straßen in einer von den meisten Menschen verlassenen geisterhaft wirkenden Stadt zum Bahnhof. Straßenbahnen fahren schon lange nicht mehr.
Unser Zug fährt pünktlich ein. Gott sei Dank! Als er die Bahnhofshalle verlässt, läuten sämtliche Glocken von Neuwied Luftlandealarm ein. Wieder mal. Es grenzt an ein Wunder, dass wir wegkommen. Noch an diesem Abend erreicht der Zug Frankfurt. Am Hauptbahnhof müssen wir aussteigen, weil der Zug nicht weiterfahren kann. Warum? Die Strecke ist bombardiert worden und muss erst abgeräumt werden. Der Bahnsteig ist zerstört, auf dem wir aussteigen. Wir keuchen die Treppe runter in die große Bahnhofshalle, die voller Leben schwirrt. Stimmengewirr, hastende Soldaten und Lautsprecherdurchsagen für die Soldaten Irgendwie tut es uns gut, mal wieder richtige Soldaten zu sehen, obwohl viele Verwundete unter ihnen sind. Heute kommen wir nicht mehr weiter. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Nachmittags soll es weitergehen. Wir lassen uns den Mut nicht nehmen. Das ferne Bayernland lockt.
Die kommende Nacht verbringen wir in einem bombensicheren Hochbunker in der Nähe des Hauptbahnhofes. Wir liegen in richtigen, bequemen Betten.
»Gute Nacht,«
»gute Nacht!« Mama, das Baby und ich haben eine Kabine für uns. Natürlich gibt es Fliegeralarm in der Nacht. Auch hier müssen wir aufstehen. In dem großen Aufenthaltsraum sitzen viele Soldaten und Zivilisten, die genau wie wir kein Zuhause mehr haben. Frau Hentz tauscht bei einem Soldaten Brotmarken gegen Zigaretten ein. Nach der Entwarnung legen wir uns wieder in unsere Betten und schlafen uns aus.
Frankfurt
Wieder eine Großstadt, die kennen zu lernen in einer anderen Zeit was Tolles wäre. Aber so? Hier wirkt alles sehr vertraut auf mich, als wir im frühen Nachmittag den Hochbunker verlassen. Wenn uns nur nicht das schwere Gepäck so quälen würde! Zerstörte Häuser, einst hohe Gebäude, jetzt nur noch ein Trümmerhaufen. Viele Menschen haben unter den Trümmern nicht überlebt, Menschen, die dasselbe Recht hatten zu leben wie wir auch. Und der Wahnsinn hält an. Es dämmert sehr bald. Wir haben uns spät auf den Weg aus dem sicheren Bunker gemacht. Auf uns Kinder macht nur der Name der Stadt Eindruck: Frankfurt am Main. Die Stadt wirkt wie jede andere zerstörte Großstadt. Die wenigen an uns vorüberhuschenden Gestalten haben alle vergrämte einheitliche Gesichter, genau wie alles in diesem Krieg: Einheitsseife, Einheitsherde, Einheitskinderwagen, Einheitszigaretten. Einheitskleidung, so auch durch Leid und Angst gezeichnete Einheitsgesichter. Man müsste die Menschen erst kennen lernen, um Unterschiede feststellen zu können. Hoffentlich gibt es keinen Fliegeralarm!
»Mam, isch han Hunger!« Heinz drückt lauthals aus, was wir empfinden.
»Wo soll ich dir jetzt jet zu esse herholle?« faucht Frau Hentz unbeherrscht unter ihrem Packen. Wir hatten morgens von unseren Vorräten gegessen. Wir finden kein intaktes Lebensmittelgeschäft. Der Kleine schnupft, heult und zieht seine Nase hoch.
»Im Bahnhof können wir sicher was essen,« meint Mama mit letzter Stimmkraft. Das leere Kochgeschirr schwingt der Kleine aufsässig durch die Luft. Ich könnte ihn . . . ! Wir haben noch Brot und Butter im Gepäck. Aber wie sollen wir hier mitten auf der Straße daran kommen? Was für ein Glück, dass wir die Reisemarken haben, sonst müssten wir sicher verhungern. Wären wir doch schon in Bayern! Unsere Verwandten werden sicher dumm gucken, dass wir nicht alleine kommen. Das ist aber jetzt egal. Gewichtig schreiten Hans und Hubert mit gefüllten Pistolentaschen am Koppel vor uns her. Kalt ist es. Der Weg vom Bunker zum Bahnhofsgebäude ist nicht weit. Wir sind aber glücklich, als wir den Bahnhof erreichen. Zuerst einmal stehen wir verfroren in der kalten provisorisch abgedeckten Halle herum und müssen uns zurechtfinden. Es werden nur noch Urlauberzüge eingesetzt. Es heißt, planmäßige Züge fahren überhaupt nicht mehr. Weibliche Stimmen schallen aus den Lautsprechern über sämtliche Bahnsteige und durch die Bahnhofshalle:
»Der Urlauberzug aus . . . hat unbestimmte Verspätung. Der Urlauberzug von . . . läuft voraussichtlich mit zwei Stunden Verspätung ein.« Uns interessiert nicht, woher die Züge kommen, sondern nur wohin sie fahren. Sehr bald wird die Einfahrt unseres Zuges angekündigt. Und los geht das Gerenne. Soldaten,die so vertraut zu unserem Leben gehörenden Gestalten, laufen fluchend in der kalten zugigen Bahnhofshalle hin und her. Die harten Kommissstiefel dröhnen. Wieder einige Soldaten drängen zurück durch die Sperre in den Wartesaal, um auf den nächsten Zug zu warten. Wir hasten mit unserem Gepäck durch die Halle. Mama versucht krampfhaft
- fast röchelnd - unsere Herde zusammenzuhalten in diesem Lärm und Chaos.
»Pass auf, guck vor dich!«
»Wie kann ich mit dem Packen auf dem Buckel aufpassen?« gibt Frau Hentz unwirsch zurück. Wir stolpern mehr, als dass wir laufen. Der kleine Heinz schwingt sein leeres Kochgeschirr wieder mal hin und her. Der Kinderwagen eiert. Die Jungen sind in Hochform. Unsere Bekannten von Haus Hardt haben wir noch nicht entdeckt. Endlich stehen wir vor der für uns zuständigen Sperre. “Kettenhunde” prüfen und kontrollieren die Urlaubsscheine der Soldaten. Wir passieren die Sperre, nachdem die Fahrkarten abgeknipst worden sind. Wir müssen die Treppe hoch zu unserem Bahnsteig, dem Bahnsteig 5. Mama und ich müssen erst das Gepäck die schmutzige breite Steintreppe herauftragen und es oben absetzen. Dann folgt der Kinderwagen. Endlich stehen wir an der richtigen Bahnsteigkante neben dem aufgestapelten Gepäck und warten auf “unseren Zug”.
So wie wir aussehen, würde man uns in Friedenszeiten Penner nennen. Ich fühle mich in meiner ausgebeulten Trainingshose überhaupt nicht wohl. Die Jungen in ihren weiten Mänteln und auch die Mama sehen noch einigermaßen aus. Den Kinderwagen schiebe ich missmutig hin und her. Hektik herrscht auf sämtlichen Bahnsteigen. Das Kind ist wach und macht seine Luftsprünge im Kinderwagen, das heißt es hopst mit dem Po immer hoch.
»Wenn wir in Würzburg sind,« sagt Mama, »machen wir einen Tag Aufenthalt. Würzburg ist noch nie von Bomberverbänden angegriffen worden, ein großes Kriegslazarett ist dort und keine Industrie. Eine wunderschöne Stadt. Die wird wohl keinen feindlichen Bombenangriff erleben müssen. Ich freue mich drauf. Mama hat ihre liebe Not, Frau Hentz daran zu hindern, in einen Zug in entgegengesetzter Richtung zu steigen. Sie hat schon einen Teil des Gepäcks auf die andere Bahnsteigkante geschafft, will es in ein Zugabteil werfen und natürlich einsteigen.
»Los misch doch,« sagt sie störrisch, »isch fahr mit minger Künger hem!«
- Als ob noch irgendein Zug in die hinter uns gelassene Front hineinfahren würde! Aber ich denke:
»Wenn sie doch abhauen würde!« Sie macht unsere Mutter verantwortlich, dass alles nicht so reibungslos abläuft, wie sie es gern hätte. Aber unbedingt mitkommen musste sie! Krächzend, schimpfend, plärrend stehen wir auf dem kalten, zugigen, teilweise zerstörten Bahnsteig und machen uns das Leben schwerer, als es bereits ist. Und wo sind die Jungen schon wieder? Eine Hilfe sind sie fürwahr nicht. Sie stehen am Treppenabgang großspurig an einem Rollfix gelehnt und quatschen mit ein paar Landsern. Frau Hentz hat die Seiten wieder gewechselt, die Jungen haben dieses Drama gar nicht mitbekommen. Die beiden kommen zurück. Wieder einmal glauben sie an den Endsieg. Es gibt die noch nicht eingesetzte Geheimwaffe, auf die alle warten. V1 und V2 sind seit langem im Einsatz. Atombombe? Ist sie noch nicht fertig? Es halten einige Züge. Aber der richtige für uns ist noch nicht dabei. Da endlich läuft unser Zug ein.
»Vorsicht an der Bahnsteigkante!« tönt es aus dem Lautsprecher. Wir heben das quietschvergnügte Kind aus dem Kinderwagen und verstauen diesen, weil wir es müssen, mit dem sperrigen Gepäck im Gepäckwagen. Hoffentlich sehen wir unsere Sachen wieder! Die übrigen Gepäckstücke behalten wir bei uns.
»Ist das auch der richtige Zug?« Mama versichert immer wieder kaum hörbar, dass es unser Zug ist. »Räder müssen rollen für den Sieg!« Die in großer weißer Druckschrift geschriebenen Parolen sind auf die meisten Eisenbahnwaggons gepinselt. Jetzt sollen die Räder uns erst mal bis Würzburg rollen. Wäre unser Zug doch schon mal raus aus dem Bahnhof, bevor es wieder Fliegeralarm gibt. Die Wagons sind noch ziemlich leer. Wir haben ein ganzes Abteil für uns. Unser Gepäck haben wir gut verstaut.. Eine schwarz angestrichene Glühbirne baumelt unter der Decke. Wir ziehen die schmutzigen Vorhänge nicht zu. Der Zug steht immer noch auf den Bahngleisen. Rotekreuzschwestern eilen auf den Bahnsteigen an die Fenster der Urlauberzüge und reichen Essen und Trinken herein. Lärmen - Rufen - Hasten - Soldaten - Lautsprecherdurchsagen. Das Baby nehme ich auf meinen Schoß. Wir sitzen hier zusammen, die Mama, der Hubert, das Kind und ich, Frau Hentz und ihre beiden Jungen. Frau Hentz ist eingeschlafen. Die kann überall pennen. Die beiden großen Jungen hänseln den kleinen Heinz.
»Heinemännsche, wat häste en schön Plätekäppsche!«
»Mam, der Hannes ärgert mich immer!« Deren Mama schläft tatsächlich.
»Lasst doch den Heinz in Ruhe!« Das ist Mamas krächzende Stimme.
»Sind Sie Flüchtlinge?« fragt uns ein SS-Soldat, der mit aufgeschultertem Gewehr durch den Zug patrouilliert. Sind wir Flüchtlinge? Eigentlich nicht. Wir machen einen höchst schäbigen Eindruck in unserer ausgebeulten Kleidung und dem uneleganten Gepäck.
»Ja, « sagen Mama und die aufgeschreckte Frau Hentz gedehnt, »eigentlich schon «.
»Dann gehen Sie nach hinten in den letzten Wagon, der ist für Sie reserviert.« Warum das denn auf einmal? Es gibt keine deutschen Flüchtlinge, höchstens Evakuierte.
»Nun machen Sie schon!« werden wir angeschnauzt. Mit unseren Utensilien laufen wir durch alle leeren Wagons bis zum letzten Wagen. Der ist auch leer. Sonderbar. Es ist ein Wagen der dritten Klasse, ausgestattet mit ein paar Holzbänken. Ehe wir uns häuslich niederlassen können, bahnt sich der altbekannte Ton den Weg durch den Bahnhofslärm - auf - ab - auf
- ab. Auch das noch! Frankfurter Luftschutzsirenen heulen einen Vollalarm in den Abend. Unser Zug kann die Bahnhofshalle nicht verlassen. Wir müssen raus.
»Los raus!« kommandiert Hubert. Frau Hentz meutert:
»Isch bliewen sette, und wenn isch kapott jon!« -
»Mama komm schon!« Unsere Gepäckstücke müssen wir hier zurücklassen und auch das im Gepäckwagen. Der SS-Mann schließt von außen den Wagen ab. Heinz klappert schon wieder mit dem Kochgeschirr. Er scheint es nie mehr loslassen zu wollen. Ein vergnügtes Baby halte ich auf dem Arm. Es begrüßt jede Abwechslung. Der kleine Heinz versucht, wie ein Hahn zu krähen, es gelingt ihm nicht so richtig.
»Büs doch still, Klöpes,« sagt sein Bruder. Wir hasten mit all den anderen Menschen die Treppen hinunter. In der Halle bleiben wir dann stehen. Hier solls sicher sein? Hoffentlich gibts bald Entwarnung. Wir wünschen uns, dass die Bomberverbände “nur” über Frankfurt hinwegfliegen. Und unser egoistischer Wunsch geht in Erfüllung. Es dauert nicht lange und es gibt Entwarnung. Wir steigen die Treppen hoch. Unser Zug steht noch da. Er hat die Bahnhofshalle nicht verlassen. Aber was ist das? Wo ist unser Abteil, unser Wagon? Das Bild hat sich in der kurzen Zwischenzeit verändert. Der gesamte Zug ist vollgestopft mit Menschen. Wo ist unser Abteil? Hysterisch und bange rennen wir den überfüllten Zug entlang. Hinter sämtlichen Abteilfenstern herrscht Leben und Betrieb. Unser großes Gepäck ist noch im Gepäckwagen. Wir erkennen den Griff vom Kinderwagen. “Unser” Wagon scheint picke packe voll besetzt zu sein. Wieso sind auf einmal so viele Menschen in dem Zug? Es ist ein Sonderzug. Das wissen wir. Der SS-Soldat ist nirgendwo mehr zu sehen.
»Vorsicht an der Bahnsteigkante, der Sonderzug nach Regensburg fährt sofort ab!« Wir stürzen in den letzten Wagon, in dem wir kaum was wiedererkennen. Wir suchen nach unserem zurückgelassenen Gepäck.
»Sieh mal, Mama da liegt deine graue Tasche!« Ja, das ist unser Abteil.
Die Gepäcknetze sind vollgestapelt mit unzähligen Habseligkeiten - nur nicht mehr mit unserem Gepäck. Die Sitzplätze sind besetzt von armselig aussehenden Menschen - wir sehen sicher genau so aus - aber das wissen wir nicht. Feindselig starren sie uns an und machen nicht einen Zentimeter Platz. Wo bleibt Hubert? Wir sind kaum drinnen im überfüllten Wagen, Mama mit dem Kind auf dem Arm, da werden von außen die Türen abgeschlossen, und Hubert ist noch nicht da. Unser hysterisches Winken nutzt nichts. Der SS-Mann, der das Abteil abschließt, verschwindet sofort und stört sich nicht an unserem Fuchteln. Dämmerts uns, ahnen wir den Irrtum der SS-Leute, der uns in diese Situation gebracht hat? Ich weiß nicht, ob wirs wissen. Aber es ist so. Die SS glaubt, wir seien Ausländer oder gar Zwangsarbeiter und sperrt uns mit diesen einfach ein. Ich habe Angst vor dem Hass dieser Menschen. Die Lokomotive pfeift. Es gibt einen harten Ruck. Der Zug setzt sich in Bewegung. Der Zug lässt Frankfurts Sirenen, die wieder Vollalarm in die Stadt heulen, hinter sich. Wo ist Hubert?
»Der wird schon in ein anderes Abteil gestiegen sein!« sagt Hans. Da stehen wir in dem dunklen Zugabteil und können uns kaum bewegen. Unsere Gepäckstücke sind auf dem Boden verteilt. Wir erkennen sie an den Umrissen. Wir stehen da, sagen nichts. Die Spannung ist unerträglich. Frau Hentz lässt sich aufseufzend auf einen Koffer fallen - ob der hält? Er hält. Er ist der einzige noch verfügbare Sitzplatz. Einige Gesichter nehmen Konturen an. Wir erschrecken vor der Starrheit und dem Hass, der unverkennbar ist. Mama kann mit dem Kind auf dem Arm kaum noch stehen, das unterhalten sein will und herausfordernd kauderwelscht. Das Mützchen hängt wie immer schief. Alle Türen sind verschlossen. Wir sind allein zwischen den fremden, bedrohlichen Menschen, die sich flüsternd in einer fremden harten Sprache unterhalten. Eine alte Frau rutscht auf ihrem Platz etwas zur Seite, was wohl bedeuten soll, dass Mama sich mit dem Kind hinsetzen kann. Die Blicke der fremden Männer und Frauen werden nicht freundlicher. Eine Unterhaltung ist in Gang gekommen. Wir verstehen natürlich kein Wort. Ich quetsche mich neben Mama und beschäftige mich mit dem Kind, das unternehmungslustig in die Dunkelheit peilt und kindliche Annäherungsversuche unternimmt. Die Fremden reden miteinander über unsere Köpfe hinweg. Wir merken, dass es um uns geht. Ich flüstere in Mamas Ohr:
»Ich glaube, das sind Po…!«
»Ich weiß,« sie winkt ängstlich ab, bevor ich das Wort “Polen” ausgesprochen habe. Ich erkenne, dass auch Mama Angst hat. Das steigert die meine ins Unermessliche. Ob diese Menschen aus irgendeinem Lager weitertransportiert werden sollen? Sind das Fremdarbeiter? Mein Gott, wie die uns hassen! Lautes Männerschimpfen übertönt plötzlich die leisen Stimmen, die sofort verstummen. Der Hans, der riesengroße Hans in seiner zu großen Volkssturmuniform - ein abgewetzter alter SA-Mantel ohne Trensen, ohne Merkmale - eigentlich nur noch ein brauner Mantel - ist die Ursache hierfür. Er lehnt lässig, groß und stark wirkend an der Abteiltür, die keinesfalls aufgehen kann, weil sie ja von außen verschlossen ist, und greift mit einer Gebärde, die provozierend auf die Ausländer wirken muss, an seine Pistolentasche. In dieser schemenhaften Umgebung wirkt aber auch alles bedrohlich.
»Lass den Blödsinn!« zischt heiser unsere Mutter.
»Ich knall das Pack über den Haufen!« Ich weiß, er meint das nicht so. Hoffentlich verstehen die Leute kein Deutsch. Frau Hentz hats gut. Die schnarcht. Der kleine Heinz schwankt im Stehen hin und her. Warum nimmt Frau Hentz ihn nicht auf den Schoß? Es geht noch mal gut. Es wird weiter gemurmelt. Hans hält seine Arme verschränkt. Der Zug braust durch die Schatten der herannahenden Nacht. Ein willkommenes Futter für die hungrigen Nachtvögel. Hoffentlich erspähen sie ihn nicht.
»Die bringens fertig und werfen uns aus dem Zugfenster, wenn Hans so weiter macht,« steigere ich unseren Horror. Hans hat sich beruhigt. Das lärmende Geschwätz ertönt wieder. Frau Hentz schreckt hoch und schimpft mit ihrem Sohn. Sie hat von nichts eine Ahnung. Der kleine Heinz heult. Brigitte schreit. Eine Flut von harten Wörtern in einer fremden Sprache ergießt sich über uns. Wie sollte es anders sein? Frau Hentz und der große Hans geben Kontra. Mama kann nichts tun. Sie hat überhaupt keine Stimme mehr. Sie zittert genauso wie ich. Im Geiste sehe ich uns schon mit den Beinen aus den Abteilfenstern hängen.
»Seid endlich ruhig!« schrei ich hysterisch. Die Vorstellung von den Abteilfenstern und den verrenkten Beinen wird mich die ganze Nacht quälen. Wieder einmal hält der Zug mit einem Ruck. Es ist Fliegeralarm, und der Zug hat keine Einfahrt in den Bahnhof. Wir stehen auf offener Strecke.
»Lieber Gott, bitte, bitte, lass uns heile hier herauskommen.« Im Verhältnis zu unserer Situation ist das eine unverschämte Bitte. Die fremden Menschen lärmen und schreien durcheinander. Mir gegenüber sitzt ein Mädchen. Es lächelt mich verlegen an, und ich lächle zurück. Das Mädchen zuckt mit den Schultern, was wohl heißen kann: Ich kann doch auch nichts dafür! Ich tu das gleiche. Denn auch ich kann nichts dafür. Befangen versuchen wir, uns anzulächeln. Ist es denn möglich? Das Geschrei geht in Flüstertöne über. Das ist unheimlich. Ich bekomme einen engen Sitzplatz freigemacht auf der Bank neben dem Mädchen und hänge mehr als dass ich sitze auf dem harten Holz. Der Zug fährt weiter. Und wieder schwellen die Stimmen an. Alle gucken in Frau Hentz Richtung, die wieder losbollern will. Mama und ich glauben zu wissen, was los ist. Mama nimmt den Rest ihrer Stimme zusammen, und fährt Frau Hentz an:
»Nimm endlich deinen Heinz auf den Schoß« Der Kleine schaukelt schlafend im Stehen hin und her. Das ist ein unmöglicher Zustand. Frau Hentz setzt ihn tatsächlich auf ihren Schoß. Die Gemüter kühlen ab. Brigitte wird von Mamas Arm auf meinen gereicht. Und der Hubert? Der ist sicher in einem anderen Abteil! Hoffentlich! Ist es noch Abend? Ist es schon Nacht? Die Fahrt scheint kein Ende nehmen zu wollen. Das Kind schläft mal wieder. Der Packen auf meinem Arm ist durchnässt. Es ist nicht möglich, das Kind sauberzumachen. Ich kann kaum noch einhalten. Das Mädchen neben mir - wir vermeiden jede mögliche Berührung - hat sich auf den Boden gehockt, und ich ahne mehr, als dass ich es weiß, was sie da unten tut. So was kann ich nicht. So ein Ferkel! Noch einige Male bleibt der Zug auf der Strecke stehen. Wie lang das jedes Mal andauert, ist uns inzwischen gleichgültig geworden. Die Hauptsache ist, dass er auch wieder abfahren kann. Nein, wir werden nicht durch die Fenster geworfen. Sicherlich ist darüber verhandelt worden, ob sies tun oder nicht. Aber Hans trägt eine Pistole. Ob sie das abhält? Die Türen bleiben nach wie vor verschlossen, auch wenn der Zug auf freier Strecke stehen bleiben muss. Wir sind Gefangene geworden unter einer zusammenhängenden großen Gruppe von Mitgefangenen, die uns sehr feindlich gesinnt ist, die uns hasst. Der Zug keucht. Ratta tsch, ratta tsch. Ich kann nicht mehr sitzen. Ich kann nicht stehen. Ich kann nicht schlafen. Ich muss mal. Ich kann auch nicht mehr wach bleiben. Hans hat sich inzwischen auf ein Gepäckstück gehockt. Zu allem Überfluss stellt sich Hunger ein.
Düster ist es, die Menschen werden zu Schemen. Die alte Frau neben Mama reicht unserer Brigitte ein Stück trockenes Brot, die mit ihren Patschhändchen danach grapscht. - Würzburg. Ist diese Stadt denn unerreichbar? Immer wieder halten wir auf offener Strecke: verdunkelte Bahnhöfe, Rotekreuzschwestern, die an allen anderen Zügen entlangeilen und heißen Kaffee reichen. Nur uns nicht. Wir können uns nicht bemerkbar machen, weil kein Mensch uns zur Kenntnis nimmt. Was wird bloß aus uns?
Endlich! Würzburg! Es tagt, als der Zug in den Bahnhof einfährt. Und Tiefflieger sind unterwegs. Und ein Wunder geschieht! Als es hell ist, werden die Abteiltüren wieder aufgeschlossen. Wer diese Schlüsselgewalt hier ausgeübt hat, kriegen wir nicht mit. Gott sei Dank, wir leben! Hubert taucht auf, steif gefroren, weil er die ganze Nacht auf der Plattform vor einem verschlossenen Wagen ausharren musste. Die Hauptsache, er ist wieder bei uns. Als sein Gesicht sich erholt hat, tut er so, als sei nichts geschehen. Wir werden von einem SS-Mann aufgefordert auszusteigen, die anderen müssen im Zug bleiben. Wir wollten ja sowieso nur bis Würzburg. Ob der Irrtum aufgefallen ist? Vielleicht ist der braune Volkssturmmantel von Hans ein Hinweis? Ich weiß es nicht. Verzweifelt, verschlafen, mit steifen Gliedern vom Sitzen und dem gebückten Stehen raffen wir unser Gepäck unter den scharfen Blicken der Mitreisenden zusammen, stolpern mit dem Kind auf dem Arm durch die geöffnete Abteiltür, die hinter uns wieder zugeschlossen wird, über den Gang auf die Plattform nur raus aus dem Zug, nur raus, nur raus! Hans und Hubert holen die großen Gepäckstücke aus dem Gepäckwagen und werfen sie auf den Bahnsteig. Ist das wahr? Sind wir in Würzburg? Mama und ich wollen den Kinderwagen holen.
»Halt! Stehen bleiben, oder ich schieße!« brüllt uns eine herrische Männerstimme an, als wir den Kinderwagen auf den Bahnsteig absetzen. Frau Hentz hat das Baby auf dem Arm. Es schreit. Mama und ich begreifen nicht, dass wir gemeint sind.
»Bliw doch stohn!« schreit Frau Hentz. Erschrocken bleiben wir stehen, drehen uns um und erstarren wie die anderen Menschen auf dem Bahnsteig - unrasierte Soldaten und einige Zivilisten. Eine Gewehrmündung ist direkt auf uns gerichtet. Der SS-Soldat in schwarzer Uniform, der uns gestern Abend in den letzten Wagen des Zuges gescheucht hatte, steht an der Bahnsteigkante und will Mama und mich erschießen. Seine blank gewienerten Stiefel fallen auf. Warum? Was haben wir getan? Schritt für Schritt nähert er sich uns mit dem angelegten Gewehr. Hubert ist an seiner Seite. Alle haben Angst. Meine Knie werden weich und drohen wegzurutschen. Wir haben die letzte Nacht überlebt - und nun? Das Baby strampelt auf Frau Hentz Arm herum. Die kleinen Fausthandschuhe sind heruntergefallen. Es bietet sich ein groteskes Bild auf dem Bahnsteig 4 in Würzburg. Da hält ein Soldat von der Waffen-SS eine Knarre auf Mutter und Kind gerichtet. Es ist ein eisig kalter Februarmorgen. Wir sind alle steif vor Entsetzen. In dieser Unbeweglichkeit registriert mein Blick, dass Mamas grauer Regenmantel mit unzähligen kleinen Winkelhaken und Schnitten übersät ist. Wie ist das möglich? Mein Unterbewusstsein antwortet unklar: Die Leute im Zug waren das! Die Flüchtlinge!
»Warum rennen Sie davon? Wohin wollen Sie? Los zurück!« Der Soldat von der Waffen-SS will uns jetzt mit seinem Gewehrkolben in den Zug zurücktreiben. Der Bogen ist überspannt Ich verliere den Bezug zur Wirklichkeit. Ich möchte mich an das Gewehr hängen und schaukeln. Lachen möchte ich und keine Angst haben.
»Wir sind keine Flüchtlinge,« versucht Hubert, den SS-Mann aufzuklären. Das Wörtchen «wir« betont er. Und mir fällt es jetzt wie Schuppen von den Augen. Der denkt wir gehören zu den polnischen Flüchtlingen im Wagon und wollen ausbüxen! Wo ist Hans? Er hat sich verdrückt. Mama gibt krächzend Erklärungen ab. Sie hat Mut.
»Sie haben uns zu den Flüchtlingen gesteckt, obwohl wir gar keine sind!« Die beiden Frauen müssen ihre Personalausweise vorzeigen, und der Mann nimmt die Knarre runter. Wir werden nicht erschossen. Ich habe uns schon hingestreckt und blutend auf dem fremden Bahnsteig liegen sehen. In die übrigen steifen Gestalten auf dem Bahnhof kehrt wieder Leben ein. Sie bewegen sich fort, als sei eine Fotografie lebendig geworden. Frau Hentz, Hans und Heinz warten in sicherer Entfernung. Der SS-Soldat entschuldigt sich nicht. Im Weggehen schnauzt er noch:
»Seien Sie froh, dass ich so human bin. Sie haben sich strafbar gemacht, weil Sie im Ausländerzug gefahren sind. Wer sagt mir, dass Sie nicht spioniert haben?« Gerade dieser SS-Mann hatte uns doch in Frankfurt in diesen Wagen geschickt!
Woher sollen wir wissen, dass in der vergangenen Nacht der erste Bombenangriff auf Würzburg stattgefunden hat? Die spätere Statistik wird nicht einmal die ungefähre Zahl der Toten festhalten können, ebenso das genaue Datum und die genaue Uhrzeit. Die nackten Zahlen auf dem Papier sagen nichts aus über den brennenden Mörtel, den Kalk, der die Augen ätzt. Eine Stadt ohne irgendeinen Bunker, eine friedliche Stadt mit einem großen Lazarett, das gekennzeichnet ist mit einem großen roten Kreuz auf weißem Untergrund - wie alle Krankenhäuser und Lazarette. Warum nur diese Stadt ohne Industrie? Dreck und Staub vom Bombenangriff hängen immer noch in der Luft. Erst jetzt bemerken wird es. Uns brennen die Augen von den Staubkörnchen in der Luft. Die Tränen sind keine geweinten.
»Du wolltest unbedingt hier aussteigen!« schimpft Frau Hentz in altbewährter Weise.
»Würzburg!« äfft sie, »eine wunderschöne Stadt, da bleiben wir einen Tag!«
»Sei doch froh, dass du heile aus dem Pollackenzug raus bist!« mischt sich Hans ein, »wer weiß, was aus uns geworden wäre?« Ja, wer weiß! Der Augenblick wird gekrönt von erneutem Heulen der Sirenen, die heile geblieben sind, erbarmungslos. Vollalarm! Rasch, rasch nur in irgendeinen Luftschutzkeller! Wären wir doch nur schon wieder weg! Das viele lästige Gepäck - könnten wirs doch einfach wegwerfen! Es geht gut
- auch ohne Luftschutzkeller. Die Entwarnung kam schneller als unser Trab dorthin. Und Wunder über Wunder - eine Stunde später fahren wir Richtung Regensburg und sitzen in einem normalen Zugabteil.
Dieses Stück Bahnfahrt wird immer wieder durch Hüpfübungen unterbrochen. Es ist Tag, und unser Zug wird immer wieder von feindlichen Tieffliegern verfolgt. Immer ein anderer. Die Tiefflieger hier sind einrumpfige Flugzeuge. Bisher waren wir die doppelrumpfigen “Lightlings” gewohnt. Das Flugzeug nähert sich dem fahrenden Zug, gleitet tiefer und tiefer und setzt zum Sturzflug an - - . Der Zug hält mit einem kräftigen Ruck auf der Strecke. Schnell, schnell raus! Die Mama hat das Kind unter den Arm geklemmt. Wir hüpfen und springen wie Rehe vor der Flinte des Jägers an den Bahndamm oder in einen Graben, der feucht ist und nach Erde riecht. Es gibt keinen Sturzflug. Es wird nicht geschossen. Aber es gibt ein nächstes Mal und wieder ein nächstes Mal: Wir kleben am Bahndamm und zwei Jabos brausen tiefer und immer tiefer über unsere Köpfe hinweg.
»Mama, gib mir deine Hand!«
»Verdammter Mist!« murmelt Hubert und zieht seine Mütze ins Gesicht. Die Maschinengewehrsalven klatschen auf den Abhang auf der anderen Seite des Bahndamms. Der Spuk dauert nicht lange. Sie drehen ab. Der Zug ist nicht getroffen worden. Wir rappeln uns auf und laufen zurück zu unserem Zug, der auf freier Strecke stehen geblieben ist und als Zielobjekt sehr gut geeignet ist. Die Felder sind aufgewühlt von Bombentrichtern. Es fahren nicht viele Menschen mit diesem Zug. Wenn möglich, fahren alle Leute nachts. Räder müssen rollen für den Sieg. Die wundersame Parole der Deutschen Reichsbahn.
Land des Lächelns
Irgendwann in diesem unserem Leben haben wirs geschafft! Wir sind wohlauf im März 1945. Wir wohnen bei Tante Rosi in Jägerwirt bei Passau auf dem Bauernhof mit der Familie Hentz. Gab es jemals diese Odyssee? Ich meine fast, es liegen Jahre dazwischen. In Wirklichkeit sind erst ein paar Wochen vergangen. Diese Horrorfahrt hat sich in nebelhafte Fernen verdrückt. Mama hat versucht, die Risse in ihrem Mantel zusammenzustopfen. Es sind viel zu viele. Es klappt nicht. Frühling macht sich tagsüber bemerkbar, und in unseren Herzen keimt Hoffnung auf. Worauf? Nein, auf keinen Sieg, sondern auf das Ende. In den zerstörten Städten wird es bald zwischen den Trümmern blühen. Schneeglöckchen, Veilchen, später Vergissmeinnicht, Hahnenfuß und Sumpfdotterblumen. Die Todesanzeigen mit dem Eisernen Kreuz in den Zeitungen gleichen sich in ihren Aussagen: »Er starb, damit Deutschland lebe!« Oder: »Im Gigantischen Ringen um das Großdeutsche Reich ließ er sein junges Leben für sein Vaterland!« Das ist kein Trost.
Ich habe am 16. März Geburtstag und werde 14 Jahre alt. Gefeiert wird nicht. Brigitte wird am 22. März ein Jahr alt. Omas und Opas schrecklicher Tod durch einen Bombenvolltreffer jährt sich am 27. März. Wir denken oft an sie. Karlheinz wird sicherlich die beiden kleinen Heldengräber in Essen aufsuchen. Er hat uns geschrieben. Von unserem Vater haben wir lange nichts gehört.
Der 1. April zieht ins Land. Wir leben mit Familie Hentz zusammen bei den Verwandten meines Vaters in Niederbayern, Jägerwirt bei Passau, Frau Hentz, Hans und Heinz. Jägerwirt ist das höchstgelegene Dorf weit und breit. Der Kirchturm mit dem niedrigen roten Dach ist kilometerweit zu erkennen. Mein Jägerwirt - auch heute noch überragt es so manches Mal mein Leben. Wir sind alle lebendig hier angekommen, alle, die wir hierher unterwegs waren. Vergleichbar mit der Zeit “vorher” leben wir im Land des Lächelns, im Zauberland, wenn wir diesen kurzen Abschnitt unseres Lebens mit dem vergleichen, dem wir entronnen sind. Leben wir im Krieg? Natürlich spüren wir ihn auch hier. Aber er ist nicht mehr so hautnah. Wir haben das Lachen wieder gelernt. Die Menschen, die hier zu Hause sind, wissen nicht, wie gut sie es haben. Bei Aigners konnten wir nicht mehr unterkommen. Bei ihnen sind schon Evakuierte aus Hamburg untergebracht. Aber das macht nichts. Dieses Stück Niederbayern ist wie eine Oase inmitten des heißen Kriegsgeschehens. Wie verdurstende Kamele traben wir umher und schlürfen gierig den kühlenden Trunk des vermeintlichen Friedens. Wir lachen, wenn wir uns das Labyrinth vorstellen, durch das wir uns schlagen mussten, bevor wir hier angekommen sind. Hier ist die Front nicht mit uns und die feindlichen Tiefflieger nicht über uns. Man glaubt es kaum - aber es ist so: wir Kinder glauben wieder an einen Endsieg. Heil Hitler! Außer uns grüßt hier kein Mensch so. Es heißt nach wie vor: Grüß Gott! Jetzt, da sich unser Körper, unsere Seele, unser Verstand normalisiert haben, gewinnen die kleinen Dinge wieder an Bedeutung. Unsere Urlaubermarken sind aufgebraucht. Sicherlich hört das gute Leben bald auf. Milch bekommen wir genügend von Tante Rosi, obwohl sie die Milch abliefern muss. Was sie abliefern muss, wird nach der Anzahl der Kühle berechnet. Wenn eine Kuh weniger Milch gibt, muss sie trotzdem das gleiche Quantum abliefern. Soldaten sind auch in Jägerwirt stationiert. Die Mädchen gehen abends mit ihnen im nahe gelegenen Wald spazieren. Auch unsere Mutter wird auf der Dorfstraße angequatscht. Ein Oberfeldwebel hat sie angesprochen und sie gefragt, ob er ihr die schöne Gegend zeigen solle. So was! Sobald die Sonne scheint, bin ich mit dem Kinderwagen unterwegs. Einmal fragt mich ein Mann.
»Jo mein, is dies schon die Kind?« So was! Doch dann nickte ich nur stolz. Er schüttelt seinen Kopf und schaut mich recht sonderbar an. Im Dorf kennt uns jeder. Hans und Hubert machen die Gegend unsicher und die kleinen Kinder bange. Und die Fronten rücken immer näher aufeinander zu. Sieg oder bolschewistisches Chaos. Diese Parole hat ihre Gültigkeit für uns nicht verloren. Manches Mal überkommt uns das bange Gefühl, dass all der Schrecken zurückkehren kann. Ob wir dann überleben? Der Führer hält die Geheimwaffe in der Hinterhand, die uns zum Sieg verhelfen soll. Der Schießplatz mitten im Wald, auf dem im vergangenen Jahr noch die Piloten vom Pockinger Flugplatz ihre Schießübungen gemacht haben, wird nicht mehr benutzt. Wir spazieren oft dorthin. Die Bäume sind gerodet. Ein großer Platz, der sich für alles Mögliche eignet. Völkerball, Fußball, Schlagball, Laufen, Spazierengehen. Und wieder einmal habe ich eine Freundin gefunden. Eine richtige Freundin.
Wir haben bei Tante Rosi im Bauernhof nur zwei Zimmer zum Schlafen. In dem einem schlafen Mama und Frau Hentz, in dem anderen schlafen die beiden Jungen. Die Zimmer liegen oben und zur Dorfstraße heraus. Unten haben wir einen größeren Raum, der uns allen als Küche und Aufenthaltsraum dient. Ich bin deshalb ständiger Gast im Hause des Dorfschullehrers, zumindest für nachts. Ich schlafe mit seinen beiden Töchtern in einem großen Schlafzimmer. Die Lehrerfamilie wohnt in der Dorfschule. Die beiden Mädchen sind meine Freundinnen geworden. Mausi und Annerl. Mausi ist schon 16 Jahre alt. Annerl ist ein Jahr jünger als ich. Annerl ist vor kurzem erst aus Schalding zurückgekehrt. Ihre Schule ist auch geschlossen worden. Sie wohnte dort bei ihrer Tante und kam nur jedes Wochenende nach Hause. Wir drei verstehen uns sehr gut. Es sind zierliche Mädchen. Und Hubert ist verknallt in das ältere, in Mausi. Wir Mädchen wollen uns Blutsfreundschaft schwören. Mausi, die eigentlich Irene heißt, hat ihr Haar vorne und an der Seite hochgekämmt und zu einer großen Rolle gewickelt. Schön sieht das aus. Sie hat natürliche Wellen. Meine Haare sind auch wieder nachgewachsen. Ich trage meine Zöpfe um den Kopf geschlungen und kämme meine Haare vorne hoch und drehe sie auch zur Seite. Das sieht toll aus. In der Dorfvolksschule unterrichtet der Vater der beiden Mädchen. Es gibt nur einen einzigen großen Klassenraum, in dem alle Volksschulklassen unterrichtet werden. Der kleine Heinz ist der einzige, der hier mit den Dorfkindern die Schulbank drücken muss. Er ist sechs Jahre alt und schulpflichtig. Das Schul- und Wohngebäude steht direkt neben der Dorfkirche. Auf der anderen Seite in einer Dorfnebenstraße befindet sich ein kleines Lebensmittelgeschäft. Der Hals der Kirche mit seinem kurzen roten Kirchturm ist rank und schlank. Die Kirche schaut weit über Täler und Höhen hinweg. Es ist ganz egal, wohin wir gehen oder mit einem Fahrrad fahren, der Kirchturm ist immer zu sehen und vermittelt ein wunderbar heimeliges Gefühl. Wir leben sorglos, nicht sorgenfrei, in jeden schönen Tag hinein, denn jeder Tag, sei er noch so wolkenverhangen, ist schön. Obwohl wir uns um unsere Angehörigen sorgen, die nicht bei uns sind, leben wir auf und denken nicht Tag und Nacht an den Tod, der uns stets hautnah bedroht hat.
Frau Hentz Haupt- und Lieblingsbeschäftigung ist das Holzhacken. Sehr oft fliegt ein Scheit haarscharf an den Köpfen ihrer Jungen vorbei. Sie ist sehr jähzornig. Mama gewöhnt sich mit Gewalt das Rauchen an, obwohl es keine Zigaretten gibt. Nur weil Frau Hentz pafft. Sie scheint auch schon süchtig zu sein. Gemeinsam mit Frau Hentz rollt sie alle möglichen Kräuter in Zeitungsrändern zu Zigaretten zusammen. Sie haben irgendwo am Rand der großen Wiese Tabak angepflanzt. Na ja!
Wir gehen den weiten Weg von Jägerwirt bis Fürstenzell oft, um unsere Verwandten zu besuchen und um einzukaufen. In Jägerwirt gibt es nur einen Laden, der nicht einmal die Dinge, die es auf Lebensmittelkarten gibt, vorrätig hat. Es ist wenig genug. Die Bauern sind alle Selbstversorger. Dann ist da noch Schmied-Lisa. Lisa arbeitet beim Dorfschmied als Pflichtjahrmädchen. Sie ist in unserem Alter. Wir sind oft mit ihr zusammen. Hans und Hubert buhlen gemeinsam um die Gunst beider Mädchen, um Lisa und um Mausi. Das Annerl und ich: wir dürren Bohnenstangen!
Tante Rosi, bei der wir ja nun leben, hat hinter ihrem Hof eine große Wiese. Dort schnattern die Enten am kleinen Weiher, dort gackern die Hühner, dort hängen wir die Wäsche auf. Tante Rosi hat einen Sohn, den Franzi. Er ist ein scheuer Junge, zehn Jahre alt, mit dem wir Kinder nicht so recht warm werden können. Er hat seine Freunde im Dorf. Er und Heinz vertragen sich. Die beiden mögen sich und spielen auch öfters zusammen. Direkt gegenüber von Tante Rosis Wohnhaus - man braucht nur über den Hof zu gehen - sind die Kuhställe. Über den Ställen ist eine kleine Wohnung. Dort wohnt die Familie Höing mit zwei Kindern, einem kleinen Jungen und einem Mädchen. Das Ehepaar arbeitet für Tante Rosi auf dem Feld und im Stall. Es sind arme Leute im landläufigen Sinne. Ich stehe mit Brigitte auf dem Arm hinterm Hoftor am Weiher.
»Jo mei,« fragt die Tochter der Höings, »sein dös alles dei Hemden, Annemie?« Ich blicke auf die Leine, auf der meine Hemden mit Schulterschluss im Verein mit anderen Wäschestücken in der Sonne trocknen und lustig im Wind flattern.
»Ja sicher, sind das meine,« sage ich.
»Jo mei, i denk, ihr seids ausgebombt?«
Wir waschen jeden Tag, obwohl nur eine einzige Pumpe draußen vor dem Haus auf der Wiese zum Feldweg hin das Wasser spendet. Wir müssen jeden Tag einige Male kräftig pumpen. Das Wasser ist rostig, aber gesund. Die Soldatenhemden, die der Hans und der Hubert in Iversheim für Brot bei den Landsern eingetauscht hatten, sind Opfer des Herdfeuers geworden. Und - toi, toi, toi - die Kleiderläuse sind wir endlich los.
Dann gibt es noch den Niedermeyer-Hof, den wir oft aufsuchen. Große Wiesen und ein großer Weiher, in dem die Jungen schwimmen, ziehen uns dorthin. Zwei stattliche Töchter haben die Niedermeyers, zwar zu alt für die Jungen, aber sie schäkern. Sie laden uns oft zum Essen ein. Sie haben Flüchtlinge aus Ungarn aufnehmen müssen, eine nette, aber undurchsichtige Familie. Sie hassen nicht gerade uns, aber die Deutschen, die Nationalsozialisten sind. Das muss ich noch sagen. Wir sind nicht mehr die ätherischen Verwandten, die man mit einer gewissen Hochachtung bedacht hatte. Es ist anders geworden. Mama musste Tante Rosi einige Male beschwichtigen. Es gab richtigen Ärger. Die beiden Jungen, der Hans und der Hubert, tun nichts lieber, als Onkel Franz, Tantes Rosis Mann, zu ärgern. Er ist wirklich nur ein Häufchen Elend unter Tante Rosis Herrschsucht und hat «nur« in den großen Bauernhof eingeheiratet. Es ist gemein, was die mit ihm anstellen. Onkel Franz hat es mit dem Herzen. Dummerweise hat Tante Rosi uns erzählt, dass Onkel Franz wegen seines Herzleidens vom Volkssturm zurückgestellt worden ist. Seine kurze Ausbildungszeit ist abgebrochen worden. Er soll bei einer Übung, während der eine Panzerfaust losgelassen wurde, in Ohnmacht gefallen sein. Da kann der Mann ja nichts zu! Er ist längst wieder zu Hause und streichelt oft seinen Hund im Hof. Seine Augen blicken müde. Der Schnäuzer hängt schief. Der Klotz zum Holzhacken steht auf dem Hof, und zwar seitlich zwischen Scheune und dem Teil des Hauses, an dem sich unser Fenster des Wohnraumes befindet. Geht man ein paar Schritte weiter in Richtung Hinterfront des Hauses, befindet neben der Scheune das Häuschen mit dem Herzchen für alle. Daneben ist die hohe Mauer aus Holzscheiten, wie sie hier überall auf den Höfen vorkommt. Es riecht stets nach Holz und Stall. Die Gänse und Enten watscheln über den Hof, die Hühner gackern aus der Scheune. Brigitte läuft schon allein, man muss sie nur noch unter einem Arm festhalten, dann rennt sie und jauchzt vor Vergnügen. Sie hat ihren Spaß, wenn man mit ihr hinter dem Federvieh herläuft.
Deutsche Soldaten sind in den Wäldern stationiert. Eines Tages haben sich die Jungen einfach freiwillig der Wehrmacht angeschlossen. Das geht! Tagsüber sind sie fort. Nachts dürfen sie nach Hause. Im Wald wird oft geschossen. Sie haben auch schon Gefangene gemacht und geben fürchterlich an damit.
Der April vergeht. Morgens, wenn wir drei Mädchen noch in den Betten liegen, singen wir schallend Volks- und Wanderlieder. Das schallt durchs ganze Schulgebäude. Mitunter sitzen die Schüler schon in den Bänken und müssen sich das anhören. Aber die beiden Mädchen haben eine schöne Stimme. Da kann ich meine gut einflechten. Wir singen zwei-, sogar dreistimmig.
Dann kommt die letzte Aprilwoche. Wir erkennen über die Felder und Hügel hinweg auf den sich weit hinter dem Dorf schlängelnden Straßen heranrollende Panzer - amerikanische. Die deutschen Soldaten, die hier im Dorf (20 Häuser, 1 Schmiede, 1 Schule, 1 Lehrer, der wohl außer dem Ortsgruppenleiter der einzige Parteigenosse hier ist) ins Bild gehörten, sind in Hast und Eile aus dem kleinen Ort verschwunden. Gut so. Auch die Jungen sind seit einigen Tagen verschwunden, ganz verschwunden, d.h. sie kommen abends nicht mehr heim. Sie wollen wohl wieder mithelfen, den Krieg zu gewinnen. Sie tragen richtige Soldatenuniformen. Irgendein Feldwebel hat sie in die Wehrmacht aufgenommen. Unglaublich! Sie bewegen sich auf einem hochgespannten Drahtseil ohne Netz und Boden.
Der 1. Mai. Mittags. Die beiden Jungen haben sich immer noch nicht blicken lassen. Frauen aus dem Dorf laufen lautschreiend von der Straße her den Feldweg zwischen Tante Rosis Wiesen hinunter auf den Hof zu. Es ist ein schöner Sonnentag. Wir stehen vor dem Bauernhaus auf der Wiese. Die gestern noch wie Ameisen wirkenden Panzer haben sich sehr stark vergrößert, bedrohlich gewaltig rollen sie unten auf der Straße heran. Die Panzerspitze hält genau vor Tante Rosis Bauernhof hinter den Wiesen.
»Mama, müssen wir jetzt sterben?« Die Jungen - wo sind die Jungen?
Von Mama nimmt das Dorfvolk wohl an, dass sie Englisch sprechen kann. Die lauten Frauen verfolgen eine gemeine Absicht. Sie haben das eigennützige Ziel, Mama an die Panzerspitze holen. Sie soll dolmetschen.
»Frau Winklhofer, Sie müssen mitkommen und den Amerikanern sagen, dass keine deutschen Soldaten mehr im Dorf sind!« Mama? Warum unsere Mutter?
»Du kommst aber mit,« sagt sie mit zittriger Stimme zu Frau Hentz, der robusten Freundin aus der Eifel. Die steht steif wie ein Stock und rührt sich nicht. Hier weiß kein Mensch, dass sie Parteimitglied ist. Ein Glück.
»Kommens endlich! Sonst erschießens uns alle!« Mama hebt das kleine Kind aus dem Einheitskinderwagen mit Anbau, das dort friedlich gesessen hat. Steif wie eine Marionette mit dem Kind auf dem Arm und mir am Rockzipfel schreitet sie den schmalen Pfad durch die Wiesen zur Straße hinunter, Frau Hentz hinter sich lassend. Die Frauen, eben noch laut, bleiben mucksmäuschenstill im Hintergrund stehen. Der Bauernhof, die zu Tode erschreckten Menschen, die Wiesen, die feindlichen Panzer, die auf uns gerichteten Geschütze und mittendrin unsere Mutter mit dem Baby auf dem Arm und mir Klette am Rock.
»Lieber Gott, beschütze uns doch bitte alle!« Mein Standardstoßgebet. Das Kind schreit. Meine Sommersprossen springen mir fast aus dem Gesicht. Wie ein Denkmal mit Kind steht Mama dann vor den Waffen der Feinde. Sie unterhält sich - als sei das die normalste Sache auf dieser Welt - mit einem amerikanischen Offizier. Der nickt nach diesem kurzen Gespräch. Steif gehen wir den Weg zurück auf den Hof zu. Die Panzer rollen weiter in Richtung auf den unheimlichen Wald. Es fällt nicht ein einziger Schuss. Mutter steht - immer noch wie eine Marionette - den Frauen aus dem Dorf freundlich Rede und Antwort. Sie habe den Amerikanern versichert, dass in den Wäldern keine deutschen Soldaten versteckt seien, und dass sich schon seit langem keine Soldaten mehr im Dorf aufhalten. Sollte sich herausstellen, dass Mama nicht die Wahrheit gesagt hat, so die Amerikaner, gehe das Dorf in Schutt und Asche unter. Die Panzer verschwinden im Wald. Es fallen keine Schüsse. Im Dorf wimmelt es plötzlich von amerikanischen Soldaten. Sie lassen alles mitgehen, was nicht niet- und nagelfest ist. Auch unsere Armbanduhren verschwinden an die mit Uhren überladenen Arme der Amis. Nach langem Suchen mit Tante Rosi entdecken wir endlich Frau Hentz zitternd vor Angst in einer Ecke im Keller. Es kostet sehr viel Überredungskunst, sie aus dem Keller herauszuholen.
Für uns ist der Krieg beendet. Wir ahnen nicht, wie lang er noch anhalten wird. Die Mädchen aus dem Dorf, die mit deutschen Soldaten in den Wald gegangen sind, gehen jetzt mit den Amerikanern spazieren. Das verstehe ich nun wirklich nicht. Am 9. Mai erfahren wir von der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen. Der Führer hat sich selbst getötet, heißt es. Wir aber glauben, er hat sich irgendwo ins Ausland abgesetzt. Der Führer lebt, heißt die Parole einiger uneinsichtiger Deutscher. Der Propagandaminister Josef Goebbels hat sich, seine Kinder und seine Frau mit Gift getötet. Admiral Döring sollte nach des Führers Tod das traurige Erbe Deutschlands verwalten. Er konnte nur noch dafür sorgen, dass endgültig Frieden herrscht in deutschen Landen. Der Krieg ist verloren - der Frieden ist eingekehrt. Irgendwann in einer Nacht zwischen den Tagen vom 1. zum 9. Mai tauchen die Jungen auf. Dreckig, verlodert, aber lebend. Sie hatten sich nach dem Einmarsch der Amerikaner im Wald versteckt gehalten. Gegessen haben sie von den Vorräten, die die deutschen Soldaten hinterlassen haben. Eine ganze Nacht lang zerschneiden Mama und Frau Hentz die Uniformen und verbrennen sie im kleinen Herd. Es geht alles gut. Niemand verpetzt sie, keiner fragt: Wo wart ihr denn?
Tante Rosis fasst das Kriegsende so zusammen:
»Jetzt sammer endlich vom preußischen Joch befreit!« Sie hat wirklich überhaupt nichts kapiert.
Ausklang
DAS ENDE. Wie sieht es aus?
Jahrelang haben wir auf den Endsieg gewartet, dann nachdem die Großstädte zerstört waren nur noch auf den Frieden. Aber immer wieder haben wir - zumindest wir Kinder - an einen Endsieg geglaubt. Es rumort ein wenig in unseren Herzen, dass die vermeintliche deutsche Geheimwaffe nicht eingesetzt worden ist. Andererseits sind wir keinesfalls überrascht, dass Deutschland den Krieg verloren hat. Der Weltkrieg ist allerdings noch nicht beendet. Da sind noch die Japaner, Deutschlands Verbündete gegen den Rest der Welt. Wann das ein Ende nimmt, wissen wir nicht. 1939 wurden die großen Schulferien verlängert, weil der Krieg ausgebrochen war. Er sollte nur 14 Tage dauern. 1945 haben wir schon lange gar keinen Schulunterricht mehr gehabt. Deutschland hat die Waffen gestreckt. Der Heil-Hitler-Gruß muss ab sofort in der Versenkung verschwinden. Die hohen Lieder der alten Schule haben ausgedient. “Deutschland, Deutschland über alles” - “Es zittern die morschen Knochen” - “Nach Ostland geht unser Ritt” - “Denn wir fahren, denn wir fahren, denn wir fahren gegen Engeland”. Ich kann sie nicht alle aufführen, die wir in Bochum an den Jungmädelnachmittagen geschmettert haben, wenn wir durch die Straßen marschiert sind. Warum sollte ich das leugnen? Schreiend, lärmend und begeistert. Jetzt müssen wir andere Lieder lernen und die, die nach uns kommen, andere lehren. Wann fängt die Schule wieder für uns an? Parolen: “Ihr Opfer war nicht umsonst.” - “Im gigantischen Ringen um die Freiheit des Großdeutschen Reiches erfüllte er die heilige Pflicht und brachte sein blutjunges Leben dem Vaterland zum Opfer.” Wie werden die Mütter und Väter heute mit diesem Schmerz fertig? Der Sieg ist ausgeblieben. Das Warten hat uns mürbe gemacht. Wir nehmen vorlieb mit dem Umkehrschluss. In den Jahren des Krieges haben wir alles hinter uns lassen müssen. Wir standen unter der Uhr des Krieges und warteten darauf, dass der Zeiger sich fortbewegte. Er ging rückwärts und zerstörte alles, was wir mal hatten.
Meine bange Frage von einst klingt heute nur noch nervtötend:
»Mama, wird es mal wieder schön so wie vor dem Krieg?« Mit Sicherheit nicht. Die Litfaßsäulen in den Städten mit ihrem unheimlichen großen Ungeheuer vor einem roten Hintergrund mit einer wurfbereiten Mine in der geöffneten Faust, verkünden noch lange Zeit die Parole: “Sieg oder bolschewistisches Chaos.” Ob es so wird? Bitte nein.
Ich sehe unsere Mutter vor mir. Die kleine Brigitte läuft kauderwelschend zwischen uns und hat von all dem nichts mitbekommen, außer einer schrecklichen Hautkrankheit, an der sie beinahe gestorben wäre. Aber - Gott sei Dank - hat sie in letzter Minute ein nach Jägerwirt geflüchteter ungarischer Arzt geheilt. Die deutschen Ärzte konnten ihr nicht helfen. Übermangansaures Kali war ihr Lebensretter, als fast alles zu Ende zu sein schien. Die Jungen: hatten sie das Soldatsein nur gespielt? Ein gefährliches Spiel. Unser Vater? Sicherlich sitzt er irgendwo hinter Stacheldraht in Kriegsgefangenschaft mit einem auf dem Rücken eingebrannten Hakenkreuz. Und Karlheinz? Er ist eigentlich auch noch ein Kind, wenn auch ein erwachsenes. Die Flakgeschütze braucht er nicht mehr zu bedienen.
Wann sehen wir uns wieder? Irgendwann müssen wir nach Hause, das gar kein Zuhause mehr ist. Die Städte liegen in Schutt und Asche. Und die unzähligen Toten, ob sie vergessen werden? Die Übriggebliebenen bauen mit blutenden Händen neue Unterkünfte. Zuerst Notunterkünfte, damit sie überhaupt weiterleben können. Die Frauen, die Kinder, die Heimkehrer, sie helfen beim Wiederaufbau. Irgendwann in einer Zeit, die noch nicht vorstellbar ist, sitzen die Menschen in ihren fertigen Häusern und haben die Toten längst vergessen. Auch die toten Helden von Stalingrad, denen wir damals in dem kältesten aller Winter in unserer lächerlichen, kindlichen Einfalt Ohrenwärmer und Handschuhe aus Wollresten gestrickt haben.