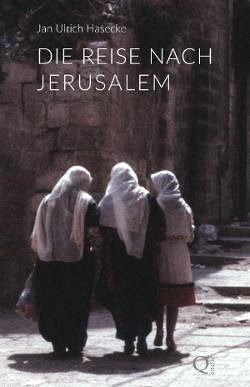Es waren junge Soldaten. Schüler, gerade 15 Jahre alt, als sie Anfang
1944 als Luftwaffenhelfer zu einer Flugabwehrbatterie eingezogen wurden.
Diese lag zum Schutz eines großen Stahlwerkes in Georgsmarienhütte.
Ich war einer von ihnen. Und zwar der Jüngste des Jahrgangs 1928, der
als letzte Altersstufe zur Flugabwehrkampfwaffe (Flak) verpflichtet
wurde.
Dreimal in der Woche fuhren wir Jungen zu unserer Schule nach Osnabrück,
um neben dem Dienst in der Stellung dennoch das Schulpensum zu erreichen
und den geistigen Anschluss nicht zu versäumen. In der übrigen Zeit
standen wir bei Tage und in den Nächten an der Kanone. Ein erfahrener
Geschützführer hatte das Kommando. Alle anderen Gefechtspositionen
wurden durch uns Luftwaffenhelfer besetzt, um die älteren Flaksoldaten
für die Fronteinsätze in Ost und West freizusetzen. Nur scheinbar waren
wir in der fliegerblauen Uniform mit den HJ-Armbinden noch Hitlerjugend,
die Wirklichkeit hatte schnell und gründlich Soldaten aus uns gemacht.
An einem Februartag 1945, wurden wir mit unseren Geschützen auf die Bahn
verladen. Stellungswechsel. Es ging nach Handorf bei Münster. Dort wurde
der Luftabwehr-Ring um den Nachtjagd-Einsatzhafen der Luftwaffe durch
unsere Batterie verstärkt. Als Ergänzung einer schweren
Großkampfstellung der Flak wurde unser Zug mit mittelschweren
Geschützen für die Abwehr von Tiefangriffen eingesetzt. Die Luft war
hier plötzlich wesentlich eisenhaltiger geworden.
Der Krieg neigte sich mehr und mehr dem Ende zu. Nach kaum vier Wochen
erfolgte ein weiterer Stellungswechsel unseres Flakzuges nach
Everswinkel. Hier wurden, wie an vielen anderen Stellen im Lande, an
wichtigen Hauptstraßen täglich Tiefangriffe amerikanischer Jagdbomber
geflogen. Neben der Reichsstraße 64 verlief eine Bahnlinie zwischen
Münster und Warendorf. Fortwährende Tiefangriffe amerikanischer
Jagdbomber auf den dort fahrenden Verkehr waren an der Tagesordnung. Aus
diesem Grunde wurden diese mobilen Straßenjagdzüge mit schnellen
Stellungswechseln innerhalb der Flak-Regimenter eingerichtet. Die Abwehr
dieser Tiefangriffe war unsere neue Aufgabe. Ständiger Alarm, zu mindest
bei Tageslicht, war angesagt. Wir wurden immer stärker gefordert und
hier hatten wir auch leider den Verlust der ersten jungen Kameraden zu
beklagen. Die Bordwaffen- und Raketenangriffe erfolgten, nachdem wir vom
Gegner erst erkannt waren, zum Teil direkt auf jedes einzelne Geschütz.
Schon nach wenigen Tagen wurden wir aus dieser Stellung zurückgezogen.
Wir landeten wieder auf unserem alten Platz am Flughafen im Ortsteil
Dorbaum. Auch hier bekamen wir wieder an jedem Tag mit den immer stärker
auftauchenden Tieffliegern zu tun. Ein deutliches Zeichen, wie schnell
sich die Front des Gegners weiter gen Norden und Osten bewegte.
Die Alliierten Truppen rückten mit ihren Panzerverbänden immer näher an
die Stadt Münster heran. Die jeweiligen Wehrmachtsberichte verhießen für
uns nichts Gutes. Inzwischen waren unsere Munitionsbunker mit
Panzersprengmunition aufgefüllt worden. Uns war gar nicht mehr wohl
dabei, wenn wir an den Einsatz im Erdkampf dachten.
Doch ganz plötzlich kam eine seltsame Wende. An irgendeiner Kommandostelle musste man wohl die Sinnlosigkeit, mit unseren 3,7 cm-Geschützen den Panzeransturm aufhalten zu können, eingesehen haben. Wir erhielten den Befehl, die Sprengungen unserer Geschütze vorzubereiten. Am nächsten Abend wurden tatsächlich die Pakete in den Verschlusskammern gezündet und die Geschütze unbrauchbar gemacht.
Die Flak-Batterie setzte sich in den Nachtstunden im Fußmarsch in Richtung Westbevern nach Nordosten ab. Wir wussten zunächst nicht, wo wir weiterhin eingesetzt werden sollten, zumal uns auch der Zerstörungsbefehl vom Vortage noch irritierte. Dieser Rückzug der Batterie bestand nur noch aus zwei Zügen und dem Tross. Etwa fünfzig Mann, die schließlich nach einem strapaziösen Nachtmarsch in den Morgenstunden auf einem Bauernhof in Westbevern eintrafen. Hier befahl der Batteriechef seinen Leuten, erst einmal ausgiebig im Stroh einer großen Scheune auszuschlafen. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass er denjenigen, der sich etwa eine Zigarette anzünden sollte, auf der Stelle erschießen werde. Immerhin sollte die „Gastfreundschaft“ des Bauern nicht mit Undank belohnt werden.
Am Nachmittag kam dann die für uns wichtige Entscheidung. Unser Batterie-Chef, ein Oberleutnant, löste die gesamte Einheit auf und beendete somit für uns den Krieg. In einem kurzen Appell machte er uns mit der Auffassung bekannt, dass mangels entsprechender infanteristischer Ausrüstung der Einheit er einen sinnvollen Widerstand nicht mehr verantworten könne. Er legte uns nahe, so geschickt wie eben möglich unterzutauchen und heimatliches Gebiet im niedersächsischen Osnabrück zu erreichen.
Die möglichen Risiken dieser bemerkenswerten Entscheidung eines
Oberleutnants, war uns Jungen in seiner Tragweite damals wohl kaum
bewusst. Immerhin wurde mit zurückflutenden „versprengten“ Soldaten, die
keinen Beweisgrund ihres Aufenthaltes bieten konnten, mitunter kurzer
Prozess gemacht. Nicht nur, was den Befehlsgeber, also unseren
Batteriechef, sondern auch jeden Einzelnen von uns betraf. Wir hatten
aufgrund der ordnungslosen Situation keine Papiere, mit denen wir die
Entlassung von unserer Einheit beweisen konnten.
Um nicht besonders aufzufallen, bildeten wir nunmehr einzelne Gruppen
und begaben uns auf den „Rückmarsch“. Keine Vorsicht wurde dabei
ausgelassen. Im Wesentlichen marschierten wir nachts. Am nächsten Morgen
erreichten wir niedersächsisches Gebiet (damals noch „Provinz Hannover“)
in der Gegend von Schwege. Bauern beherbergten und beköstigten uns. Die
Erwachsenen sahen, dass wir für unser Alter sehr viel leisten mussten
und eigentlich eine verbrecherische Regierung versucht hatte, uns zu
verheizen. Auf diesem Bauernhof spürten wir das in besonderer Weise. Wir
konnten über den Tag im Stroh schlafen wir erhielten alte Zivilkleidung.
Unsere Uniformen versteckten wir in der Scheune, um sie später einmal
abzuholen.
Bei dieser „Einkleidung“ in ziviles Outfit stellten wir sogar taktische Überlegungen an. Der Kleinste unserer Gruppe von sieben Jungen erhielt kurze Hosen, die ihn durchaus noch „kindlicher“ erscheinen ließen (das meinte jedenfalls die nette Bäuerin). Er sollte in kritischen Situationen unser „Späher“ sein, da uns nicht wohlgesonnene Menschen oder gar unsere Gegner einen daherspazierenden Jungen kaum als verkappten Soldaten angesehen hätten. Es sollte sich zeigen, dass wir diese Vorsichtsmaßnahme durchaus nicht umsonst geplant hatten.
Ungeduldig brachen wir schließlich noch vor der Dämmerung wieder auf.
Eigentlich etwas zu früh, wie sich bald herausstellen sollte. Wir
wollten die Reichsstraße 51 überqueren und inspizierten zunächst hinter
einer Wallhecke in Deckung gehend, das Gelände. Zu unserem Schreck
beobachteten wir auf der Straße vor uns einen langen Zug deutscher
Gefangener, die nach Norden zogen. Britische Soldaten in Fahrzeugen
begleiteten sie. Vorerst mussten wir also Geduld haben und in der
Deckung bleiben. Plötzlich tauchte hinter uns, quer über die Felder auf
uns zukommend, ein polnischer Kriegsgefangener auf, der wohl bis jetzt
in der Landwirtschaft arbeiten musste. Er stolperte fast über unsere gut
getarnte Gruppe, erschrak sehr und lief laut rufend auf die Engländer
zu. Wir konnten nur noch blitzschnell reagieren und, durch die
Wallhecke verdeckt, im Sturmschritt den Rückzug antreten. Wir hatten
Glück und wurden nicht gefunden. Im Dunkel des späteren Abends verließen
wir unser neues Versteck und wanderten, vorerst und in der weiteren
Nacht unbehelligt, weiter gen Norden auf den Teutoburger Wald zu.
Später wandten wir uns, durch immer wieder bemerkte Militärkolonnen und
Panzer, wieder mehr nach Nordwesten, um schließlich in der Gegend von
Lienen den Teutoburger Wald zu erreichen. Man hatte uns davor allerdings
besonders gewarnt, da sich angeblich dort in den Wäldern Einheiten der
Waffen-SS verschanzt hatten. Auf unserem Rückmarsch hat kaum jemals
größere Vorsicht unsererseits geherrscht, als in der Finsternis dieser
Wälder. Wir kamen schließlich in der Morgenfrühe ungeschoren im
wunderschönen Kirschendorf Hagen an. Dort hatte einer unserer Kameraden
einen Verwandten, einen Gärtnermeister. Er war, weil er verwundet wurde,
schon zeitiger aus dem Krieg wieder zu Hause. Die Familie nahm uns
freundlich auf und es gab zu essen und zu trinken.
Der Krieg war bereits seit zwei Tagen durch dieses Dorf gezogen. Britische Einheiten, die in Richtung Osnabrück vorstießen. Dort war auch unser Ziel. Wir entschlossen uns, nochmals die Gruppe zu verkleinern, um weniger aufzufallen. Es schwärmte immer mehr Militär umher, da wir sozusagen mit der alliierten Front mitgezogen waren, besser gesagt, sie eingeholt hatten. So zog ich dann gegen Abend, noch bei hellem Licht, mit einem einzigen Kameraden weiter. Wenig später lagen wir wieder mal im Unterholz vor einer tiefer liegenden Straße. Wir warteten, dass sich dort unten das Leben etwas beruhigen würde, damit wir ungesehen die Straße queren und auf der anderen Seite durch Wald und Feld weiter kommen konnten. An dieser Stelle nun, machte ich eine tiefgreifende und nachhaltige Erfahrung.
Hier ging mir plötzlich und deutlich der letzte Rest eines anerzogenen Glaubens an die Möglichkeit des Sieges endgültig verloren. Die ganzen jungen Jahre, in denen wir nationalsozialistisch erzogen wurden, in denen uns ein gerechtes Deutschland und ein gerechter Krieg eingeprägt worden war, diese festsitzende Zuversicht war mir an diesem Dorfrand mit einem Schlag genommen worden.
Nicht die Massen von Panzern oder die ebenso große Überlegenheit der Flugzeuge des damaligen Gegners hatten diesen „Absturz“ bei mir herbeigeführt, sondern ein einziger britischer Soldat. Er fuhr, während wir beide hier in der Deckung lagen, ganz allein in einem offenen Jeep sitzend, nur mit einer MP bewaffnet, auf eben dieser Straße in Richtung Dorf. Der Soldat schien auch nicht die geringste Sorge bezüglich einer Gegenwehr zu haben. Er wirkte absolut sicher. Er vermittelte den Eindruck, der Krieg sei längst vorbei.
Wir haben es in dieser Nacht nicht mehr geschafft, unsere Heimatstadt Osnabrück zu erreichen. Noch einen letzten Sprung machten wir am Nachmittag des nächsten Tages, nachdem wir einige Stunden in einem privaten kleinen Luftschutzbunker einer gastfreundlichen Familie geschlafen hatten.
Es war der 5. April 1945. An diesem Tage hatten wir es geschafft und Osnabrück erreicht. Wir wunderten uns allerdings, dass alle Straßen wie leergefegt waren und wir keinen Menschen trafen. Wir kamen in eine tote Stadt. Da unser beider Elternhäuser sich in einem Stadtrandbereich befanden, brauchten wir nur eine kurze Strecke um diese zu erreichen.
Glücklich waren nun alle, den unverletzten Sohn wieder in die Arme schließen zu können. Glücklich war natürlich auch ich, die Last der Ungewissheit ablegen zu können. Dies in ganz besonderem Maße, als mich meine Mutter aufklärte, warum wir in eine „tote Stadt“ gekommen waren. Am Tage zuvor, als die britischen Truppen in Osnabrück eingezogen waren, hatte es einen Anschlag der „Wehrwölfe“ gegeben. Aus einem Kellerfenster war ein englischer Soldat erschossen worden, obwohl die Stadt nicht „kämpfend“ sondern ohne Widerstand eingenommen wurde. Als „Strafe“ war deshalb für diesen Mittwoch eine ganztägige Ausgangsperre verhängt worden. Mir lief es nachträglich kalt den Rücken hinab, als ich mir ausmalte, nach tage- und nächtelangen Strapazen, in letzter Minute, praktisch vor dem Elternhaus, noch in Gefangenschaft geraten zu sein.
Mein Kriegsende war eine Episode, in der ich wochenlang noch einmal die besondere Härte und Sinnlosigkeit des Stahlgewitters erfahren musste. Es war auch der Beginn der Zeit, als das Nachdenken eines in der Hitlerjugend erzogenen Jungen begann, warum es eigentlich in den zwölf Jahren der Diktatur so weit hatte kommen können. Ein schockartiger Identitätsverlust wurde abgeschwächt durch die glückliche Heimkehr in die Familie.
Viele Menschen hatten nicht ein solches Glück. Und es sollte auch nicht
vergessen werden, dass es Offiziere gab, die eine kämpfende Einheit, die
überwiegend aus Jungen im Alter von 16 Jahren bestand, auflöste, weil
die Sinnlosigkeit des Kampfes offenbar wurde.
Unser „Führer“ aber, den dies im Einzelnen nicht zu berühren schien,
lebte noch drei Wochen in seinem Bunker weiter, während noch einmal auf
allen Seiten der Fronten Soldaten und in den Städten die Bombenopfer zu
Hunderttausenden sterben mussten.