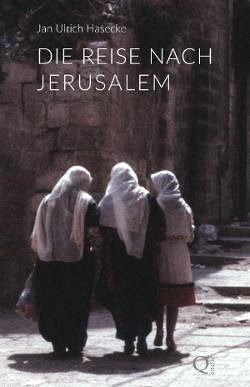Der Winter 1946/47 war bitterkalt. Wir froren jämmerlich, hatten weder gute warme Bekleidung, noch Geld, um Kohlen zu kaufen. Wir, das waren meine Mutter, meine zwei Geschwister und ich, sechseinhalb Jahre jung. Wir waren zwei Jahre zuvor in einem in Polen noch eisigeren Winter in einem offenen Viehwaggon aus Posen geflüchtet. Dabei waren mir beide Beine bis zu den Knien erfroren. Zwei Jahre später litt ich noch immer an den Folgen dieser Erfrierungen. Die Füße wurden bei der winterlichen Kälte glasig und rot, platzten auf und eiterten.
Es hatte uns in eine kleine Stadt in der Lüneburger Heide verschlagen, wir hatten wie die meisten Flüchtlinge alles verloren, was man nur verlieren konnte. Meine Mutter bekam nach unserer Flucht aus unerfindlichen Gründen auch drei Jahre lang keine Zahlungen aus der Pension meines bereits 1942 verstorbenen Vaters. Wir bettelten, hamsterten und hungerten uns durch, wohnten in einer winzigen Wohnung, mussten jeden Tropfen Wasser eimerweise vom oberen Stockwerk holen und das Schmutzwasser wiederum eine Treppe tiefer im Garten ausleeren. Zum Glück gab es ein Wasserklosett im Haus, das von allen Hausbewohnern benutzt wurde. Mit diesem Luxus waren damals noch längst nicht alle Häuser in unserer neuen Heimat ausgestattet.
In der Villa, in der wir eine bescheidene Unterkunft gefunden hatten, waren außer uns noch zwei weitere Flüchtlingsfamilien einquartiert. Die Hausbesitzerin, eine harte, geizige Frau, machte uns das Leben mit Vorschriften und Einschränkungen schwer und borgte uns nur sichtlich ungern etwas von ihren alten, oft schon brüchigen Möbeln und Gebrauchsgegenständen. Am Heiligen Abend 1946 schenkte sie uns drei Äpfel und drei Birnen, für jedes Kind einen Apfel und eine Birne. Sie hatte im Keller Regale voller Obst aus dem eigenen Garten, Mengen von Äpfeln, die verführerisch dufteten. Aber die vergitterten Regale waren abgeschlossen, damit nur ja kein einziger Apfel von uns Flüchtlingen gestohlen wurde. Aber die alte Frau konnte ihr Obst selbst gar nicht aufessen und trug jede Woche die verfaulten Äpfel auf den Kompost. Doch ein vierter Apfel zu Weihnachten, ein Apfel auch für unsere Mutter, hätte ihre Nächstenliebe oder Barmherzigkeit anscheinend überstrapaziert.
Als Kind habe ich sie für böse gehalten, doch das war sie nicht. Ihr Herz war lediglich für die verzweifelte Situation, in der wir uns befanden, zu klein und zu eng. Später, als ich erwachsen wurde, begriff ich, dass es auch für sie, die bisher ihr großes Haus allein bewohnt hatte, nicht leicht gewesen sein konnte, so viele fremde Menschen zu beherbergen und sogar ihre Toilette mit ihnen zu teilen. Sie betonte oft, dass wir nur ihre »Zwangsmieter« wären. Die Stadtverwaltung hatte nämlich alle Hausbesitzer, die über genügend Platz verfügten, dazu verdonnert, Flüchtlinge aufzunehmen.
Ein Flüchtling war in den Augen der Einheimischen nicht viel besser als ein Zigeuner. Jedenfalls erinnere ich mich, dass uns viele Einheimische mit blanker Abneigung begegneten. So hatte ich zu dieser Zeit auch nur wenige Spielkameraden. Einige Kinder gaben offen zu, dass ihre Eltern ihnen verboten hätten, mit den Flüchtlingskindern zu spielen. Um so erfreuter war ich, als eines Tages ein Mädchen, das keinerlei Not leiden musste, das alles besaß, was ich nicht mehr hatte - Spielzeug, warme Kleidung, ordentliche Schuhe, genug zu essen und ein warmes Zuhause - mich dazu aufforderte, mit ihr zu »glitschen«. Nicht auf den überschwemmten und gefrorenen Wiesen in der Nähe unserer Straße, sondern in ihrem Garten auf einer ganz besonderen »Glitschbahn«.
Im Nachbarhaus, in dem das Mädchen wohnte, gab es noch ein Plumpsklo im Garten. Die Fäkalien wurden durch eine schmale, etliche Meter lange Rinne in eine große, offene Jauchegrube geleitet, deren Inhalt gelegentlich ausgeschöpft und über den Garten verteilt wurde. Dieser Graben war in der Eiseskälte fest zugefroren, teilweise auch die Grube. Nur in der Mitte klaffte ein Loch. Wer dort schlidderte - was keinem vernünftigen Kind eingefallen wäre! -, musste also aufpassen, dass er nicht ins Loch rutschte! Es war dem Nachbarmädchen streng verboten, dort zu spielen, doch das wusste ich nicht. Und obgleich es mir auf dem braunen, unebenen und so unappetitlichen Eis gar keine rechte Freude machte, glitschte ich mit ihr, weil ich froh war, überhaupt einmal von einem einheimischen Kind »erwünscht« zu sein.
Es kam, wie es kommen musste. Ich konnte nicht rechtzeitig bremsen und sauste in die Kloake hinein, stand bis zur Brust in der eiskalten Senkgrube und schrie vor Grausen und Entsetzen. Schrie und schrie und kam trotz aller Anstrengung nicht allein heraus. Das Nachbarmädchen, ein Jahr älter als ich, rannte zuerst in Panik davon, kam dann aber glücklicherweise doch zurück, um mich herauszuziehen. »Sag’s nicht meinen Eltern!« rief sie immerfort. Sie hatte nur Angst davor, bestraft zu werden, weil sie das Verbot missachtet hatte. Mitleid hatte sie nicht mit mir.
Nachdem sie mir aus der Jauche herausgeholfen hatte, ließ sie mich stehen und verdrückte sich in die warme Wohnung des Hauses. Ich ging schreiend über die Straße hinüber zu uns, wobei ich die Arme steif von mir weghielt. Der ganze Unrat, die ekligen Brocken, die mit der widerlichen braunen Brühe durchtränkte Kleidung, alles fror in Sekundenschnelle an mir fest. Sogar die langen blonden Zöpfe standen steif und braun ab. Meine Mutter packte das schiere Entsetzen, als sie mich so sah, und versuchte mir die gefrorene, stinkende Kleidung so schnell wie möglich vom Körper zu ziehen, was nicht einfach war.
Als ich nackt in unserer kalten Wohnung stand, wurde ich in aller Eile gewaschen. Auch das Wasser in der Blechschüssel war kalt, eiskalt sogar, und ich ließ die Prozedur zähneklappernd und weinend über mich ergehen. Das Wasser zu erwärmen, dafür war wegen der Kälte keine Zeit. Danach wurde ich ins Bett gesteckt, worüber ich nur froh war, denn ich fühlte mich krank. Wahrscheinlich war ich regelrecht unterkühlt. Aber eine ärztliche Behandlung oder Untersuchung gab es in unserer Situation damals nicht. Auch über die Gefahr, die von der Jauche selbst ausging, musste hinweggesehen werden.
Natürlich erfuhren die Eltern des Mädchens aus dem Nachbarhaus umgehend von meinem Missgeschick. Die Mutter kam herüber zu uns, sah mich im Bett liegen, jammerte “ach” und “nein, sowas”, brachte aber kein noch so bescheidenes warmes Kleidungsstück ihrer Tochter, um mir wenigstens vorübergehend auszuhelfen.
Ich musste mehrere Tage im Bett verbringen, denn ich hatte mich erstens schwer erkältet und zweitens keine andere halbwegs warme Kleidung. Meine gewaschenen Sachen trockneten in der Kälte nur langsam. Die Schuhe aber überstanden mein Abenteuer nicht schadlos, und das war tatsächlich eine Katastrophe: Der Gestank, der trotz aller Bemühungen an ihnen festklebte, war das kleinere Übel. Dass sie nach dem minutenlangen Aufenthalt in der Jauchegrube jedoch geschrumpft waren, war viel schlimmer. Meine blutenden, eiternden Füße, die ich in die viel zu engen Schuhe zwängen musste, litten Qualen. Doch ich hatte nur dieses eine Paar. Und eine lindernde Salbe für die Erfrierungen, mit denen ich noch lange zu kämpfen hatte, bekam ich erst Jahre später.
Gott sei Dank gab es auch Menschen, die nicht an der erwähnten Herzkrankheit litten, sondern hilfsbereit und gütig waren. Dabei denke ich mit besonderer Dankbarkeit an eine stille, einfache, bescheidene Frau. Wenn ich mittags frierend und ganz »zufällig« zu ihr schlich, durfte ich bei ihr im Warmen sitzen, bekam ein Blatt Papier zum Malen und manchmal auch eine Kleinigkeit zu essen. Ich bin sicher, dass ihr der Herrgott ihre Freundlichkeit in der Zwischenzeit tausendfach vergolten hat.